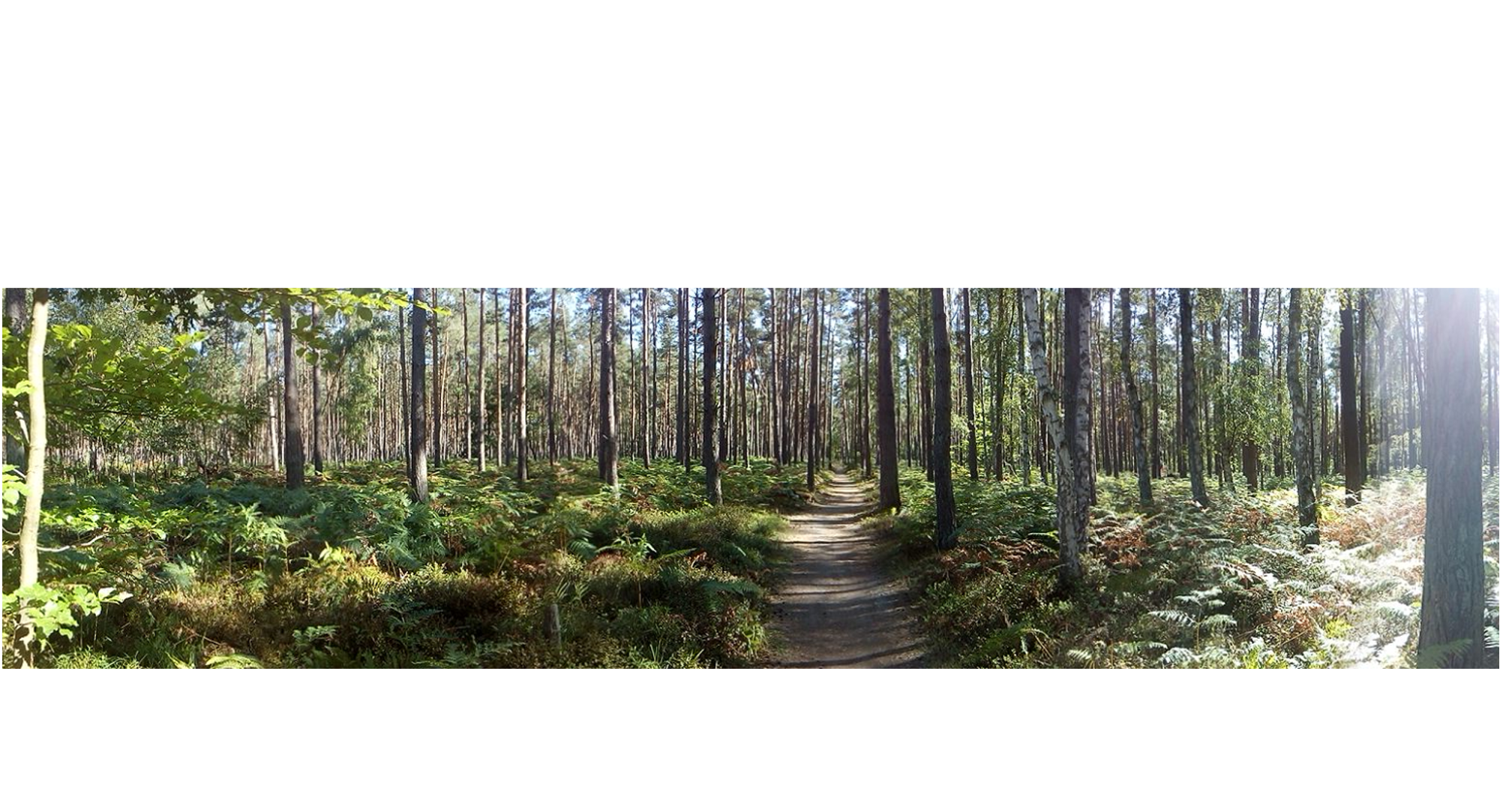Man kann sich ja streiten, ob die Wissenschaft wirklich so viele schwer verständliche Begriffe braucht, die es Menschen ohne Universitätserfahrung oft unmöglich machen, mitzureden. Aber ich habe in der Uni einige Begriffe gelernt, die wirklich nützlich sind, weil sie mir helfen, Erfahrungen zu verstehen, die sonst total rätselhaft bleiben würden.
Der Begriff „Dispositiv“ erklärt zum Beispiel wunderbar, warum ich manchmal Sachen mache, obwohl ich die überhaupt nicht machen will. Zum Beispiel kam neulich eine Mail über den Emailverteiler von meinem Verein „Asylbegleitung Mittelhessen e.v.“, dass dringend Leute gesucht werden, die einen Fahrdienst übernehmen. Nun hab ich eigentlich Ferien und tausend Projekte, für die ich nur jetzt Zeit habe. Und trotzdem hab ich mich auf die Mail hin gemeldet und einen Fahrdienst übernommen. Warum? Ich könnte jetzt behaupten, weil ich so ein guter Mensch bin und gerne anderen helfe. Aber das ist höchstens ein Viertel der Wahrheit. Ein weiteres Viertel ist: Ich stehe auf Anerkennung, und wenn ich mich in meiner Freizeit für Geflohene engagiere, bekomme ich Anerkennung von meinem sozialen Umfeld. Bleiben noch 50 % unerklärt.
Diese 50% kann ich mit dem Begriff „Dispositiv“ erklären. Ich habe den Begriff in einem Seminar von Jens Wissel über die Arbeiten von Nicos Poulantzas gelernt. Dispositive bringen mich dazu, mich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Genauer gesagt erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten. Wie sie das tun, kann man an dem Beispiel „Asylbegleitung“ analysieren: Erstmal ist das nur ein Wort. Aber dieses Wort ruft sofort Assoziationen hervor, die durch Diskurse vorgeprägt sind: Ich denke an das Asylrecht, an den Schutz von politisch Verfolgten, an Menschen, die Hilfe brauchen und an die verdammten Nazis, die gegen Asylsuchende kämpfen und sie zum Teil sogar umbringen. Aus diesem Wissen entsteht eine Handlungsregel: Hilf Verfolgten! Das ist dann in dem Wort „Begleitung“ genauer ausgedrückt. Nun ist dieser Begriff aber nicht nur ein Begriff, sondern auch der Name von unserem Verein. Und der Verein hat eine Satzung und eine Mailingliste,es gelten dort bestimmte Regeln des sozialen Umgangs und des Sprechens und es gibt Aufgaben im Sinne der Vereinsziele. Der Verein ist eine Institution, eine „durch Normen geregelte soziale Beziehung“ (Max Weber). Der Begriff „Asylbegleitung“ ist mit dieser Institution verknüpft und mit ihren Regeln, sowie mit deren Mailingliste und deren materiellen Ressourcen und Gegenständen (den Computern und dem Raum, in dem wir uns zweimal im Monat treffen), und mit bestimmten moralischen Überzeugungen (Hilf Verfolgten! Baue eine weltoffene Gesellschaft auf!) und vor allem mit einer gemeinsamen Form von Praxis (Diskussionen bei den Vereinstreffen, Sprachkursen, Fahrradwerkstatt mit den Geflohenen usw.). Den Zusammenhang von alldiesen Begriffen, Erzählungen, moralischen Einstellungen, Regeln, materiellen Gegenständen, Praxisformen, Diskussionen und Erwartungen begreife ich als das Dispositiv „Asylbegleitung“: Dieser Zusammenhang macht es wahrscheinlicher, dass ich, statt meine Projekte zu vollenden, den Fahrdienst übernehme. Es ist nicht so, dass mich das Dispositiv zwingt, das zu tun: Ich könnte mich auch anders entscheiden. Aber es würde mich Kraft kosten, gegen das Dispositiv zu entscheiden. Und ich versuche in der Regel, unnötige Anstrengung zu vermeiden. Also: Fahrdienst.
Diejenigen, die den Begriff „Dispositiv“ von Michel Foucault kennen, werden sich schon eine Weile wundern, warum ich ausgerechnet das Beispiel „Asylbegleitung“ ausgesucht habe. Denn „Dispositiv“ wird in der Tradition von Foucault vor allem verwendet, um Formen von Unterdrückung und Herrschaft zu benennen. Dispositive werden als Machtinstrumente gesehen und daher abgelehnt, weil sie die Freiheit von Menschen stark einschränken, aus der Perspektive von manchen Leuten sogar abschaffen.
Ich habe das Beipiel ausgesucht, weil ich zeigen will, dass Dispositive zwar immer Machtinstrumente sind, diese Machtinstrumente aber von Gruppen von Personen geschaffen und verwendet werden können, um etwas sinnvolles zu erreichen. Macht ist hier im Sinne Hannah Arendts etwas, das Gruppen von Menschen durch Absprachen und gemeinsame Praxis erzeugen. Ohne das Dispositiv „Asylbegleitung“ gäbe es zwar diesen Haufen Leute in Mittelhessen, die irgendwie Asylsuchenden helfen wollen, aber unsere Handlungen wären viel wirkungsloser, unorganisierter und ineffektiver. Weil wir gemeinsam dieses Dispositiv „Asylbegleitung“ erzeugen, können wir viel mehr erreichen. Jetzt könnte man sagen: Schrecklich! Nur durch Unterwerfung kann man viel erreichen. Ich kann aber die Art, wie unser Dispositiv aufgebaut ist und wie es wirkt, mitbestimmen. Deshalb ist es tendenziell sogar emanzipativ: Es schafft Freiräume.
In der Taz war heute ein Artikel von Georg Seeßlen, in dem Giorgio Agamben zitiert wird, demzufolge wir mit so mächtigen Dispositiven lebten, dass es keine Demokratie mit freier Mitbestimmung mehr sei, sondern „Postdemokratie“. Als Beispiel hat der Taz-Autor das Dispositiv „Deutschsein“ angeführt. Weil es dieses Dispositiv gebe, zwinge Schäuble die Griechen zum Sparen und pöbelten die Rassisten vor den Unterkünften von Geflohenen. (Georg Seeßlen: „Das deutsche Dispositiv“, In: Taz vom 27.8. 2015, S. 12.).
Ich stimme dem soweit zu, dass „Deutschsein“ ein mächtiges Dispositiv ist, das es wahrscheinlicher macht, dass Leute sich auf eine falsche Weise verhalten, nämlich nationalistisch. Aber ich lehne die Meinung ab, das alle Dispositive böse sind. Unser Dispositiv „Asylbegleitung“ ist ein selbstgeschaffenes Instrument, mit dem wir rassistische Dispositive effektiver bekämpfen können als ohne so ein Instrument. Solange unsere Diskussion und unsere Entscheidungsprozesse im Verein gleichberechtigt und frei sind, ist das Instrument gut.
Wenn viele Menschen solche Formen von Dispositiven entwickeln, dann bannt das die Gefahr einer Postdemokratie. Letztendlich ist auch die parlamentarische Demokratie, wenn genügend Menschen sie aktiv mitgestalten, ein solches freiheitliches Dispositiv.
Ich werbe sehr dafür, die parlamentarische Demokratie als ein umkämpftes Dispositiv zu sehen, dem die Linke nicht den Rücken zukehren sollte, weil sowieso alles „Postdemokratie“ sei und die Menschen nichts mehr zu sagen hätten. Es gibt leider Prozesse, die in diese Richtung laufen, wenn zum Beispiel über 2 Millionen Europäer*innen gegen TTIP unterschreiben, die Bundesregierung und die EU-Kommission das Freihandelsabkommen aber weiter durchsetzen wollen. Die Entmachtung der Parlamente wäre eine Folge dieses Abkommens, weil statt der Parlamente dann im Rahmen des „Living Agreements“ TTIP ein transatlantsicher Regulationsrat mit Lobbyisten wichtige politische Entscheidungen treffen würde. Poulantzas nennt so eine postdemokratische Form der Entscheidungsfindung dann „Autoritären Etatismus“ (und zwar schon in den 70er Jahren).
Aber die Parlamente sind noch nicht entmachtet und nicht alle deutschen Staatsbürger*innen sind überzeugt, dass „Deutschsein“ jetzt das wichtigste Dispositiv von allen ist. Manche Dispositive sind zu bekämpfen (wie „Deutschsein“ als Name für deutschen Nationalismus), manche sind zu erkämpfen (wie die parlamentarische Demokratie) und manche sind Instrumente im Kampf für ein besseres Leben für alle (wie Asylbegleitung).