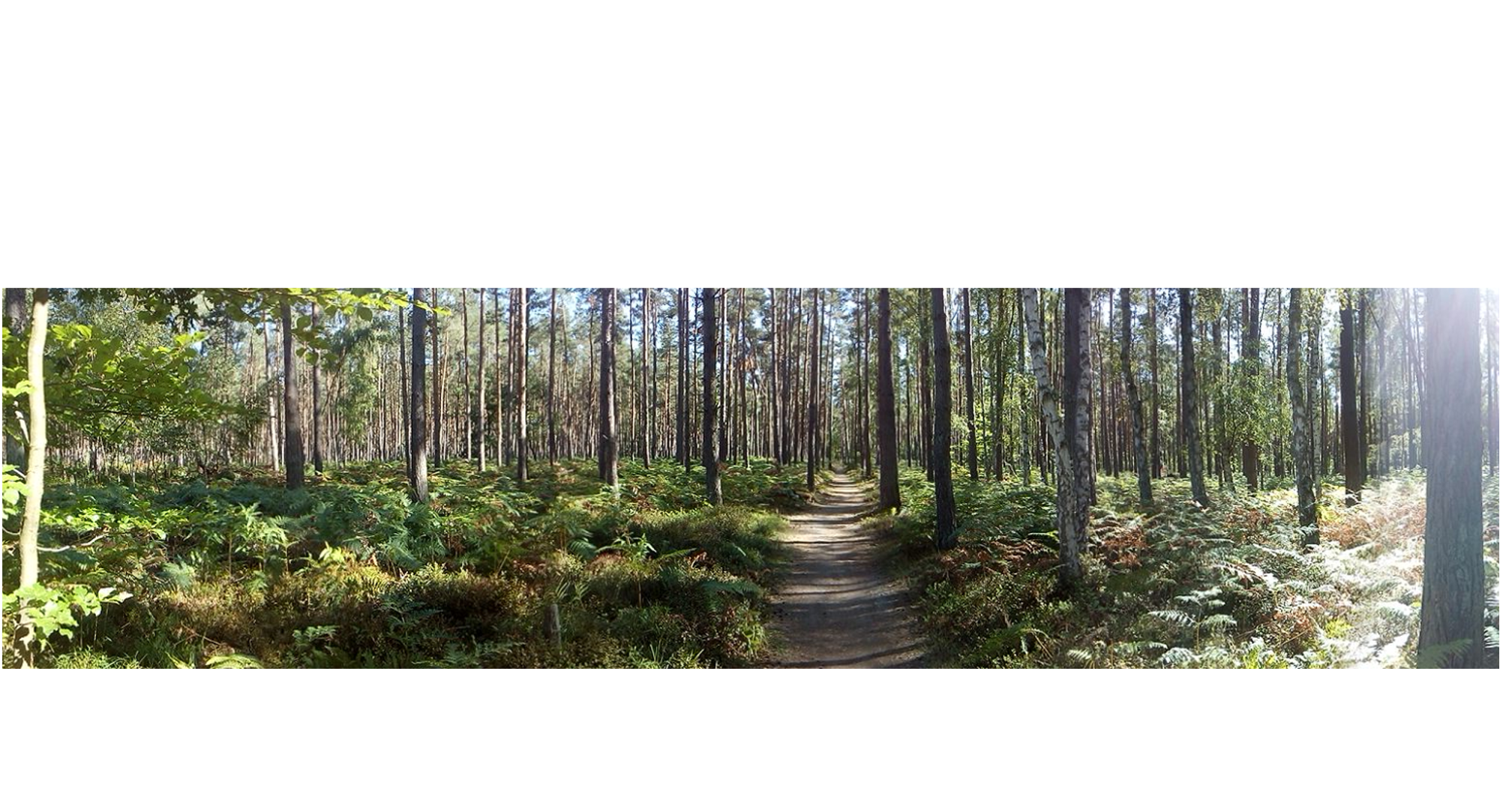Diesen Blog habe ich Utopolitan genannt, weil er (wenn auch ironisch verfremdet) eine Art Online-Magazin für utopisches Denken und Handeln werden sollte. Das ist er, vielleicht zum Glück, nicht ganz geworden.
Gerade habe ich für meinen Unterricht Teile von Hans Jonas „Das Prinzip Verantwortung“ gelesen. Besonders interessant ist nicht nur, dass er schon 1979 auf anderthalb Seiten alle wichtigen Analysen und Prognosen der Klimakrise knapp zusammenfasst, inklusive Kipppunkten, sondern auch eine Ethik aus der Verletzlichkeit lebendiger Wesen ableitet, wie es Judith Butler in „Die Macht der Gewaltlosigkeit“ tut.
Für mich und diesen Blog sind darüber hinaus seine Überlegungen zu Utopien besonders bedenkenswert. Er schreibt nämlich, dass er Utopien ablehnt und sie für schädlich hält. Er schaut sich die philosophischen Utopien der Marxisten, vor allem von Ernst Bloch und Marx selbst an, und weist überzeugend nach, dass wir sie nicht wirklich wollen können.
Besonders überzeugend ist sein Argument, dass utopisches Denken gegenwärtig lebende Menschen immer zu Mitteln degradiere, die den Zielen zukünftiger Menschen dienten. Er plädiert stattdessen dafür, sich der Arbeit und den Aufgaben zu stellen, die unser Leben von uns fordert, sobald wir wahrnehmen und akzeptieren, dass wir Menschen und unsere Gesellschaften immer unvollkommen, fehlerhaft und fehlbar sein werden.
Soweit ich ihn bisher verstehe, ist sein Argument gegen Utopien vor allem dieses: Ignorieren wir die prinzipielle und nie überwindbare Unvollkommenheit von Menschen und Gesellschaften und lassen Utopien unser Handeln bestimmen, dann tendieren wir dazu, ideologisch und totalitär zu handeln, weil wir andere Menschen und uns selbst in den Dienst einer perfekten Gesellschaft der Zukunft stellen, die wir auch gegen Widerstand von anderen schaffen müssen, koste es in der Gegenwart, was es wolle. Und zwar selbst dann, wenn wir nicht bestimmen können oder wollen, wie diese perfekte Gesellschaft beschaffen sein sollte, sondern das späteren Menschen überlassen wollen. Die Menschheit sei nämlich in solchem utopischen Denken noch nicht voll verwirklicht, nicht vollkommen sie selbst, sondern werde erst in der Zukunft verwirklicht, weshalb wir heute lebenden Menschen in diesem Denken sozusagen nur ein Zwischenstadium auf dem Weg dorthin sind, der Sinn und Zweck unserer Existenz liege im utopischen Denken deshalb darin, die volle Entfaltung der Menschheit in der Zukunft zu ermöglichen, nicht in unserer eigenen Existenz hier und heute.
Zuerst dachte ich, ich schließe diesen Blog oder benenne ihn um, denn das ist so überzeugend und unbestreitbar vernünftig, dass mir erstmal kein Gegenargument eingefallen ist.
Dann habe ich etwas darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass Jonas Ethik der Verantwortung eigentlich eine Struktur hat, die eine ähnliche Folge wie das utopische Denken hat. „Handle stets so, dass die Folgen Deines Handelns vereinbar sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ ist sein verantwortungsethischer Imperativ. Das bedeutet aber auch, dass meine Existenz heute immer auch dem Sinn und Ziel dient, menschliches Leben auf Dauer zu sichern. Er beschäftigt sich zwar mit dem Argument, dass es nicht wirklich eine zwingende moralische Argumentation gibt, die von uns heutigen Menschen abverlangen kann, dass wir auch neue Menschen auf die Welt bringen – vertraut aber einfach darauf, dass der Fortpflanzunsgtrieb sowieso dafür sorgen wird, dass es immer eine nächste Generation geben wird, um deren Existenz und menschenwürdiges Leben wir uns sorgen müssen, für die wir also Verantwortung übernehmen müssen.
Nehmen wir aber einmal an, Posthumanist*innen hätten die gesamte Weltbevölkerung der Zukunft mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse davon überzeugt, dass das Leben auf der Erde unter der Menschheit mehr leidet, als dass die Menschheit dem Leben nützt, und alle Menschen hätten deshalb aus Achtung und Sorge um das Leben aller anderen Lebewesen beschlossen, so konsequent zu verhüten, dass keine neue Generation von Menschen mehr entsteht. Das wäre nach allen moralischen Maßstäben, die ich kenne, keine unmoralische Entscheidung, weil es in der Autonomie der Menschen liegt, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Es kann für Menschen keine Pflicht geben, sich fortzupflanzen, sobald bewiesen ist, dass die Menschen allen anderen Lebwesen mehr schaden als nützen, wofür aktuell einiges spricht, ohne der Forschung da vorgreifen zu wollen. Robin Wall Kimmerer möge mir die Konstruktion dieses Gedankenexperiments verzeihen. (Sie glaubt, dass wir menschliche Kulturen erhalten und neu schaffen können, die uns Menschen zu einem heilenden Element der Biosphäre machen).
Das einzige moralische Argument, das ich sehe, warum die Menschheit unbedingt weiterleben muss, selbst wenn sie den anderen Lebewesen mehr schadet als nützt, ist, dass wir uns durch Kultur, Sprache und Technik von Naturzwängen freier gemacht haben, als alle anderen uns bekannten Lebewesen das können, und Freiheit ist ein so zentraler Wert, dass wir die Pflicht haben, ihn zu schützen, selbst wenn die Biosphäre darunter leidet.
Nun ist es so, dass wir nicht widerspruchsfrei argumentieren können, um der Freiheit willen hätten wir uns der Pflicht unterzuordnen, uns fortzupflanzen, weil das ja unsere Freiheit empfindlich einschränken und so zu einem Selbstwiderspruch führen würde.
In der fiktiven Situation des Gedankenexperiments wäre der verantwortungsethische Imperativ von Hans Jonas nicht mehr zwingend, weil die freiwillige und allgemeine Verhütung zwar die Permanenz menschlichen Lebens auf Erden unmöglich machen würde, trotzdem aber verantwortungsethisch gedacht nicht unmoralisch ist, sondern genau das Gegenteil: Eine verantwortliche gemeinsame Entscheidung.
Es wäre allerdings eine Reihe Folgeprobleme zu bewältigen, unter anderem, wie ein würdiges Altern und Sterben der Menschheit unter diesen Bedingungen möglich wäre, wenn wir das nicht durch Pflegeroboter mit eingebauter Halbwertszeit garantieren wollen. Außerdem müssen wir natürlich mit der Fallibilität unserer wissenschaftliche Erkenntnisse rechnen, wir können uns eben auch dann, wenn wir sehr kluge und informierte Posthumanist*innen sind, in so fundamentalen Fragen wie dem Effekt der Existenz der Menschheit auf die Biosphäre und das Leben allgemein gründlich täuschen.
Ein Schüler von mir aus der 10ten Klasse hat mir zum Beispiel ein ziemlich gewichtiges Argument mitgegeben, warum es evolutionär trotz aller Schäden für das Leben Sinn macht, dass die Biosphäre die Menschen hervorgebracht und sich so hat entwickeln lassen: Die Menschheit scheint eine ziemlich erfolgversprechende Methode zu sein, dafür zu sorgen, dass das Leben auch eine verheerende Katastrophe, etwa den Einschlag eines Kometen auf der Erde, überleben kann, indem es sich durch Raumfahrt auf andere Himmelskörper ausbreitet und so die Wahrscheinlichkeit erhöht, selbst nach einer Katastrophe, die den Planeten unbewohnbar macht, weiterzuexistieren.
Ich würde aus meinem Gedankenexperiment diesen Schluss ziehen: Wenn wir überhaupt verantwortungsethisch denken wollen, dann brauchen wir begrenzt utopisches Denken. Das kann zum Beispiel daraus entwickelt werden, was Robin Wall Kimmerer entwirft: Menschliche Kulturen der Zukunft, die sich auf indigene Traditionen stützen und das Leben schützen und fördern, und zugleich eine Zivilisation bilden, die den schädlichen Impact von Raumfahrt auf die Biosphäre verantworten kann, ohne mehr Schaden als Nutzen anzurichten oder das Leben auf dem Planeten gar unmöglich zu machen.
Tatsächlich ist das natürlich nur eine Variante utopischen Denkens angesichts der ökologischen Krise der Gegenwart, eine andere wäre zum Beispiel, zu akzeptieren, dass nach allem, was wir wissen, das Leben auch als Ganzes Grenzen in der Zeit hat und das vielleicht auch in Ordnung ist, wenn wir nicht mutwillig und spezies-egoistisch daraus ableiten zu können glauben, dass wir der Biosphäre alles antun dürfen, was wir können, sondern es im Gegenteil als unsere Aufgabe ansehen, das Leben, so lange es uns möglich ist, hier auf der Erde zu pflegen und zu schützen, bis wir mit ihm zusammen durch natürliche Ursachen enden.
Mein Plädoyer für begrenztes utopisches Denken ist inmitten einer ziemlich ausufernden utopischen Spekulation zum Stehen gekommen – weshalb ich es an dieser Stelle wiederholen und ihm Folge leisten möchte. Ich denke, Grenzen in der Zeit sind eine Variante begrenzten utopischen Denkens, begrenzt wäre also die letzte Utopievariante, nicht die Version mit der Raumfahrt und der Auswanderung des Lebens ins All. Hier schließe ich mich Hans Jonas an in der Haltung, die Akzeptanz von Endlichkeit, Begrenztheit und Unvollkommenheit dem Streben nach Unendlichkeit, Ewigkeit und Perfektion vorzuziehen. Denn auch die Unterordnung unter das Ziel, das Leben um jeden Preis zu erhalten, auch gegen Kometen, macht uns und auch alle anderen Lebewesen der Gegenwart zu bloßen Mitteln für die zukünftige Existenz von anderen Lebewesen – ethisch keine gut begründbare Position, weil sie sich bis ins Unendliche fortsetzen ließe, so dass es nie eine Gemeinschaft von Lebewesen gäbe, die zuerst (und vielleicht sogar nur) ihrer gemeinsamen gegenwärtigen Existenz zuliebe da wäre. Was wäre dann das Leben, sollte es irgendwann enden, was wahrscheinlicher ist als das Gegenteil, gewesen?