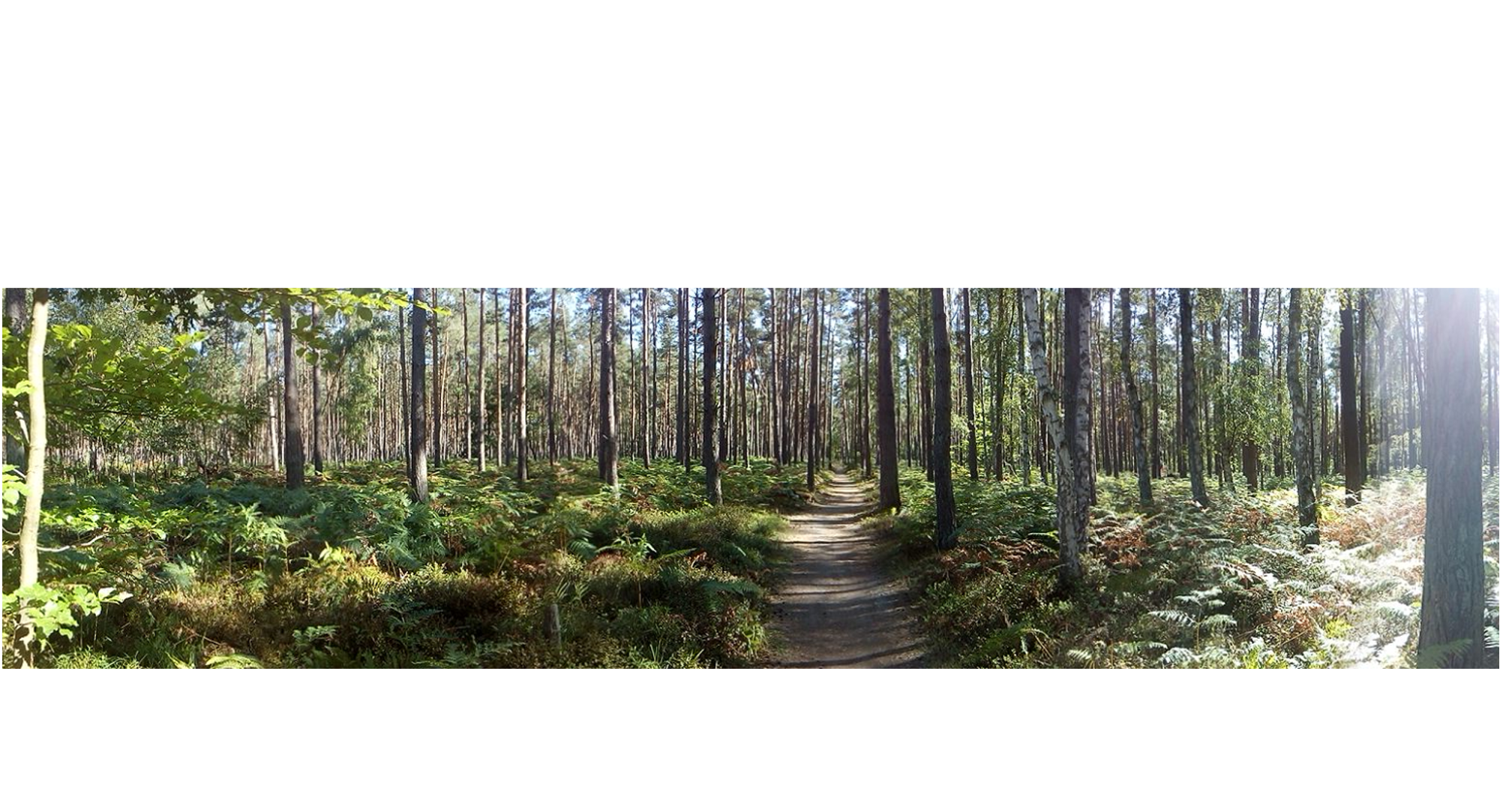Ich lese gerade nach einem Impuls einer befreundeten Meeresbiologin das Lehrbuch „Essentials of Ecology“ von Townsend et al. Das ist für einen Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler wie mich außerordentlich lehrreich, weil es meine Konzepte von Wissenschaft in Bewegung bringt. Da bin ich natürlich gar nicht besonders originell, sondern in ehrwürdiger Tradition: Niklas Luhmann hat zum Beispiel wesentliche Elemente seiner soziologischen Theorien den Naturwissenschaften entlehnt, sein Konzept der Autopoeisis (Selbsthervorbringung) von Systemen stammt aus der Kognitionsbiologie von Maturana und Varela. Ein weiteres naturwissenschaftlich inspiriertes Element seiner Soziologie ist die Hypothese, dass Gesellschaften sich durch Evolution und nicht durch Revolution entwickeln.
Ich will aus diesen Annahmen eine Erklärung herleiten, warum Rechtspopulismus eine zwar verstehbare, aber zugleich falsche und destruktive Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte ist.
Zuerst will ich erklären, wieso Luhmann seine Hypothese der Evolution von Gesellschaften entwickelt hat. Nach Luhmann ist einer der wichtigsten evolutionären Schritte der Entwicklung von Gesellschaften der letzten 300 Jahre die Entwicklung von stratifikatorischen (absolutistischen) Gesellschaften zu funktional differenzierten Gesellschaften. Am Beispiel des Verhältnisses von Wirtschaft und Politik erklärt bedeutete dieser Evolutionsschritt: Vorher war die Wirtschaft und die Politik eines Landes auf das Zentrum des Königshauses hin organisiert. Im absoluten Herrscherhaus liefen sowohl die Fäden der Macht, als auch des Geldes zusammen und von diesem Zentrum aus wurden die ökonomischen und politischen Entscheidungen für die Gesellschaft organisiert. Im Absolutismus war also der König die Sonne und deren Strahlen organisierten die umliegende Gesellschaft politisch und wirtschaftlich (um mal ein bekanntes herrschaftsverbrämendes Bild zu zitieren).
Im Gegensatz zu anderen Gesellschaftswissenschaftlern sieht Luhmann es nicht so, dass 1789 durch die Revolution in Frankreich diese Gesellschaftsform willentlich und bewusst vom französischen Volk abgeschafft wurde, um eine neue, die bürgerliche Demokratie, an ihre Stelle zu setzen, sondern die Gesellschaft hat sich eigenlogisch so entwickelt, dass aus einem Zentralsystem einzelne, voneinander abgegrenzte Teilsysteme entstanden sind, die jeweils einzelne Funktionen für die Gesamtgesellschaft erfüllen. Das nennt Luhmann „funktionale Differenzierung“. Die Politik als Teilsystem der Gesellschaft habe nach diesem Entwicklungsschritt die Funktion übernommen, für die Gesellschaft kollektiv bindende Entscheidungen zu generieren. Die Wirtschaft als Teilsystem habe die Funktion übernommen, die Gesellschaft mit knappen Gütern zu versorgen, zum Beispiel mit Nahrungsmitteln (im Gegensatz zu relativ frei verfügbaren Gütern wie Luft, wofür die Gesellschaft erstmal kein System braucht). Die neue Gesellschaft hatte dann anstelle eines einzigen Systems parallel die demokratischen Institutionen und davon unabhängig den Markt und die Ökonomie.
Diese Funktionssysteme schließen sich nach Luhmann gegeneinander ab, indem sie ein jeweils eigenes Kommunikationsmedium für ihre Kommunikationen verwenden und einen jeweils eigenen Code. Das politische System kommuniziere im generalisierten Kommunikationsmedium Macht und im binären Code „Regierung-Opposition“. Alles, was keinen Einfluss auf die Machtverhältnisse habe (also dafür, wer regiert und wer opponiert), sei für das politische System nicht beobachtbar und kommunizierbar. Das Wirtschaftssystem dagegen kommuniziere im Medium Geld und mit dem Code „Zahlung-Nichtzahlung“. Es könne daher nur beobachten und kommunizieren, was in diesem Code beschreibbar sei. Um das an einem fiktiven Beispiel zu erklären: Wenn die Regierung der BRD beschlösse, dass ab jetzt im Straßenverkehr bei roten Ampeln gefahren würde und bei grünen Ampeln stehenzubleiben sei, dann wäre das für die Wirtschaft egal, weil es keinen im Medium Geld kommunizierbaren Unterschied machen würde. Die Ampeln könnten alle bleiben wie sie sind, der Staat müsste keine neuen installieren, es würde nichts kosten und auch keinen Gewinn bringen, deshalb würde das Wirtschaftssystem darauf gar nicht reagieren.
Die Bürger*innen würden allerdings furchtbar wütend werden, weil sie sich mühsam umgewöhnen müssten, und würden die Regierung wahrscheinlich abwählen, weil die Aktion nur Mühe und Gefahren und keinen Sinn machen würde. Also wäre das im Medium Macht relevante Information.
So funktioniert nach Luhmann funktionale Differenzierung. Ein weiteres gesellschaftliches Teilsystem neben Wirtschaft und Politik ist zum Beispiel Wissenschaft. Auch sie hat einen eigenen Code (wahr/falsch).
Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum sich diese Gesellschaft von mehreren Funktionssystemen evolutionär gegen die stratifikatorische Gesellschaft mit einem Zentrum durchgesetzt hat. Wenn ich den Gedanken der Evolution ernst nehme, dann müssen die funktional differenzierten Gesellschaften ja Selektionsvorteile gegenüber zentralisierten Gesellschaften haben, sonst würden sie sich in der Evolution nicht durchsetzen.
Vielleicht hilft bei der Beantwortung dieser Frage wieder die Evolutionsbiologie. In dem Essentials Buch wird der Begriff „community“ für das verwendet, was ich früher noch als „Ökosystem“ gelernt habe: Als „community“ bezeichnen Evolutionsbiolog*innen eine Art Lebensgemeinschaft von Organismen verschiedener Spezies, die in einem bestimmten Raum zusammenleben und miteinander in Interaktion (Konkurrenz, Ergänzung oder gegenseitige Unterstützung) stehen. In diesem Sinne sind zum Beispiel alle Organismen, die in den Alpen leben, eine community. (Ich werde im Folgenden „community“ mit „Gemeinwesen“ übersetzen).
Jetzt kann ich mir die Frage stellen, welchen Evolutionsvorteil Gemeinwesen mit funktionaler Differenzierung gegenüber Gemeinwesen haben, die auf ein einziges Zentrum ausgerichtet sind, also in der Metapher eine zentrale Spezies, sagen wir: Die alpine Fichte. Offensichtlich ist ein Gemeinwesen, das auf eine einzige Spezies ausgerichtet ist, genauso stabil, wie es diese Spezies ist. Wenn sich Umweltbedingungen so ändern, dass diese Spezies nicht mehr gut überleben kann, ist das ganze Gemeinwesen in Gefahr, unterzugehen, sagen wir: Durch die Klimaerwärmung. Gibt es aber andere Spezies, ist das Gemeinwesen also differenziert und diversifiziert, im Bild: Gibt es Douglasien, Kiefern und Lärchen zusätzlich zur Fichte, können die anderen Spezies Ausfälle der Systemleistungen, die die Fichte erbracht hatte, kompensieren. Die Lärche würde sich nach meinem biologischen Laienwissen wahrscheinlich nicht durchsetzen, aber Douglasien und Kiefern könnten sich auf Standorte geschädigter Fichte-Populationen ausbreiten. Das Gemeinwesen ist dann stabiler gegenüber Stress durch sich verändernde Umweltbedingungen und kann sich besser an sie anpassen, als ein Gemeinwesen, in dem es nur die Fichte gibt. Dadurch setzen sich in der Evolution tendenziell funktional differenzierte, diversifizierte Gemeinwesen gegenüber solchen durch, die arm an Spezies und zentralisiert sind. Der entsprechende Lehrsatz der biologischen Ökologie ist: Je diversifizierter ein System ist, je mehr unterschiedliche Spezies es also enthält, desto anpassungsfähiger und deshalb stabiler ist es als ganzes.
Nun komme ich zum Kern meiner Hypothese: Um die Frage zu beantworten, ob die AfD und andere rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien in Europa und den USA die richtigen Antworten auf die Krisen der Gegenwart vorschlagen, können wir diese evolutionssoziologische Analyse verwenden.
Die wichtigste Veränderung der Umweltbedingungen für die Gemeinwesen ist aus meiner Sicht seit Jahrzehnten die Globalisierung. Was passiert ist, lässt sich mit Luhmanns Konzepten so beschreiben, dass sich die wirtschaftlichen Funktionssysteme einzelner Staaten zunehmend international miteinander verzahnt haben, also aus nationalen Subsystemen ein großes internationales Wirtschaftssystem geworden ist. In einer Art Koevolution ziehen die politischen Subsysteme nach, was sichtbar wird in der Suprastaatlichkeit der EU und in den G8 und G20 Gipfeln. Es zeigt sich hier meiner Hypothese nach, dass die Funktionssysteme wie Spezies in einer community sich nicht nur funktional ergänzen, sondern zugleich auch in Konkurrenzverhältnissen zueinander stehen und einander verdrängen können. Die internationale Verzahnung der Wirtschaftssysteme stellt einen Selektionsvorteil der Wirtschaftssysteme gegenüber den weniger international verzahnten politischen Systemen dar. Die Wirtschaftssysteme transformierten sich metaphorisch gesprochen von Subsystemen der nationalen Gemeinwesen zu Umweltbedingungen für diese nationalen Gemeinwesen. Das ist ziemlich ähnlich dem, was die Spezies Mensch spätestens in den letzten 500 Jahren im Bezug auf die ökologischen Spezies-Communities gemacht hat: Unsere Spezies und unsere Gesellschaft haben sich selbst von einem Teil der ökologischen Gemeinschaften zu einem Umweltfaktor für alle ökologischen Gemeinschaften global gemacht, Die Gesellschaft der Menschen gestaltet zu einem maßgeblichen Teil heute die Umwelt für die anderen Spezies und die communities, in denen sie leben. Ein Schlüssel für diesen evolutionären Erfolg der Spezies Mensch ist genau die Globalisierung und die Verzahnung der Wirtschaftssysteme miteinander. (Karl Marx schreibt schon 1848 im kommunistischen Manifest sinngemäß: „Der Kapitalismus hat die Weltwirtschaft faktisch verwirklicht.“).
Ich denke, dass wir an einer Art Kipppunkt der sozialen Evolution der Weltgesellschaft sind. Es könnte sein, dass sich die Weltwirtschaft als Zentrum einer auf einer neuen Ebene wieder stratifikatorisch organisierten Weltgesellschaft durchsetzt und die anderen Funktionssysteme auf sich ausrichtet. Es würde sich also als nächster Evolutionsschritt eine neue stratifikatorische, zentralisierte Ordnung entwickeln zwischen den nach wie vor differenzierten Funktionssystemen. Ganz im Sinne von Luhmanns deskriptivem soziologischen Ansatz kann ich das erstmal nüchtern als mögliche nächste Phase in einer historischen Entwicklung beschreiben. Möglicherweise ist die Tendenz dazu eine Folge der Krisen von Konkurrenz und Kriegen zwischen den Nationen und dem Scheitern von Imperien, die in einem anderen globalen Gesellschaftssystem evolutionär münden. Das würde dann aber gleichzeitig bedeuten, dass die Organisationen gemeinsamer Selbstbestimmung (also die Demokratien, die politische Systeme brauchen) durch das Wirtschaftssystem entmachtet oder sogar verdrängt werden könnten.
David Salomon hat mir erzählt, dass August Bebel gesagt hat: „Der Antisemitismus ist der Antikapitalismus der dummen Kerls.“ (Ich glaube nicht, dass er so etwas vergleichsweise Väterliches auch noch gesagt hätte, wenn er Zeuge der Shoa geworden wäre.)
Parallel dazu können wir heute sagen: „Der Rechtspopulismus ist die Globalisierungskritik der dummen Kerls.“ Die Rechtspopulisten verhalten sich so, als glaubten sie, dass wir eine neue stratifikatorische Weltordnung, in der die Weltwirtschaft das Zentrum der Funktionssysteme bildet, mit wiederhergestellter nationaler Souveränität der politischen Systeme kombinieren könnten. Bezogen auf die AfD erschließt sich daraus, warum deren Parteiprogramm fordert, Sozialleistungen zu kürzen und die Oberschicht steuerlich zu entlasten, zugleich die Grenzen zu schließen und aus der EU auszutreten. Die Utopie des AfD Programms ist eine souveränere Nation Deutschland, die Reichtum durch Kapitalismus generiert, ohne auf Menschen und Nationen außerhalb der Staatsgrenzen Rücksicht zu nehmen. Um in der globalen Konkurrenz unter der Hegemonie des Wirtschaftssystems erfolgreich sein zu können, müssen deshalb logischerweise die Arbeitskosten im Land minimiert werden (also niedrige Löhne und Sozialabgaben), das Kapital konzentriert werden (also niedrige Steuern) und zugleich die internationalen Verpflichtungen des politischen Systems reduziert werden (also Rückzug aus der EU und internationalen Abkommen).
In sich widersprüchlich ist diese Utopie deshalb, weil nationale Souveränität zwar pro forma gefordert, aber schon von vornherein ausgeschlossen ist: Souverän im eigentlichen Sinne des Wortes wäre in dieser Utopie keine Nation mehr, weil das Weltwirtschaftssystem die Umweltbedingungen setzen würde und es deshalb kaum noch Selbstbestimmung und Entscheidungsgewalt einzelner demokratischer Gemeinwesen mehr gäbe. Die Logik der ökonomischen Konkurrenz würde in einer solchen Zukunft die kollektiv bindenden Entscheidungen in jedem Nationalstaat bestimmen.
Das ist soweit klassische Globalisierungskritik, wie sie seit Jahrzehnten von attac und anderen Organisationen geübt wird. Sie argumentiert normativ, indem sie sich auf die Werte der französischen Revolution beruft: Freiheit, Gleichheit und Solidarität seien nur möglich, wenn demokratische Selbstbestimmung gegen die Logik der Ökonomie bestehen könne.
Was aber ergibt sich, wenn ich diese normative Setzung einklammere, und mit Hans Kelsen werterelativistisch davon ausgehe, dass der Wert der wirtschaftlichen Sicherheit genausogut als zentraler Wert an die Stelle von Freiheit gesetzt werden kann? (Vgl. Hans Kelsen: „Was ist Gerechtigkeit?“ Stuttart: Reclam.)
Evolutionssoziologisch problematisch ist vor allem eine wahrscheinliche Folge der oben skizzierten rechtspopulistischen Utopie: Die relative Instabilität des neuen globalen Gesellschaftssystems durch dessen stratifikatorische Ausrichtung auf die Wirtschaft als zentrale „Spezies“ des „ökologischen Gemeinwesens“. Denn diese würde die Fähigkeit der Weltgesellschaft verringern, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, weil alternative Funktionssysteme (wie die Politik, aber z.B. auch die Wissenschaft) geschwächt und in Peripherie und Dependenz verdrängt würden. Damit würden die Potentiale dieser Systeme verringert, bei starken Veränderungen der Umweltbedingungen Anpassungsprobleme der Weltwirtschaft auszugleichen.
Dialektischerweise erzeugt zusätzlich aktuell die Weltwirtschaft aber gleichzeitig, befeuert durch die zentralisierte Position der Ökonomie, genau solche schnellen und radikalen Veränderungen der Umweltbedingungen: Die Klimaerwärmung, das Artensterben und die großflächige Umgestaltung von Habitaten auf dem Land und in den Meeren sind Beispiele dafür. Die Utopie der Rechtspopulisten läuft also darauf hinaus, das Gesellschaftssystem unflexibler und weniger anpassungsfähig zu machen und zeitgleich seine Umweltbedingungen radikal und schnell zu verändern. Das ist offensichtlich eine Garantie für Desaster.
Also komme ich auch dann, wenn ich die Werte der französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ als normative Kriterien aus der Beurteilung ausklammere und stattdessen wirtschaftliche Sicherheit als zentralen Wert annehme, mit den Mitteln einer evolutionssoziologischen Beschreibung der Situation zu dem Ergebnis, dass das Programm des Rechtspopulismus, sollte es hegemonial werden, die Krisen der Gegenwart desaströs verschlimmern würde, statt sie zu lösen.