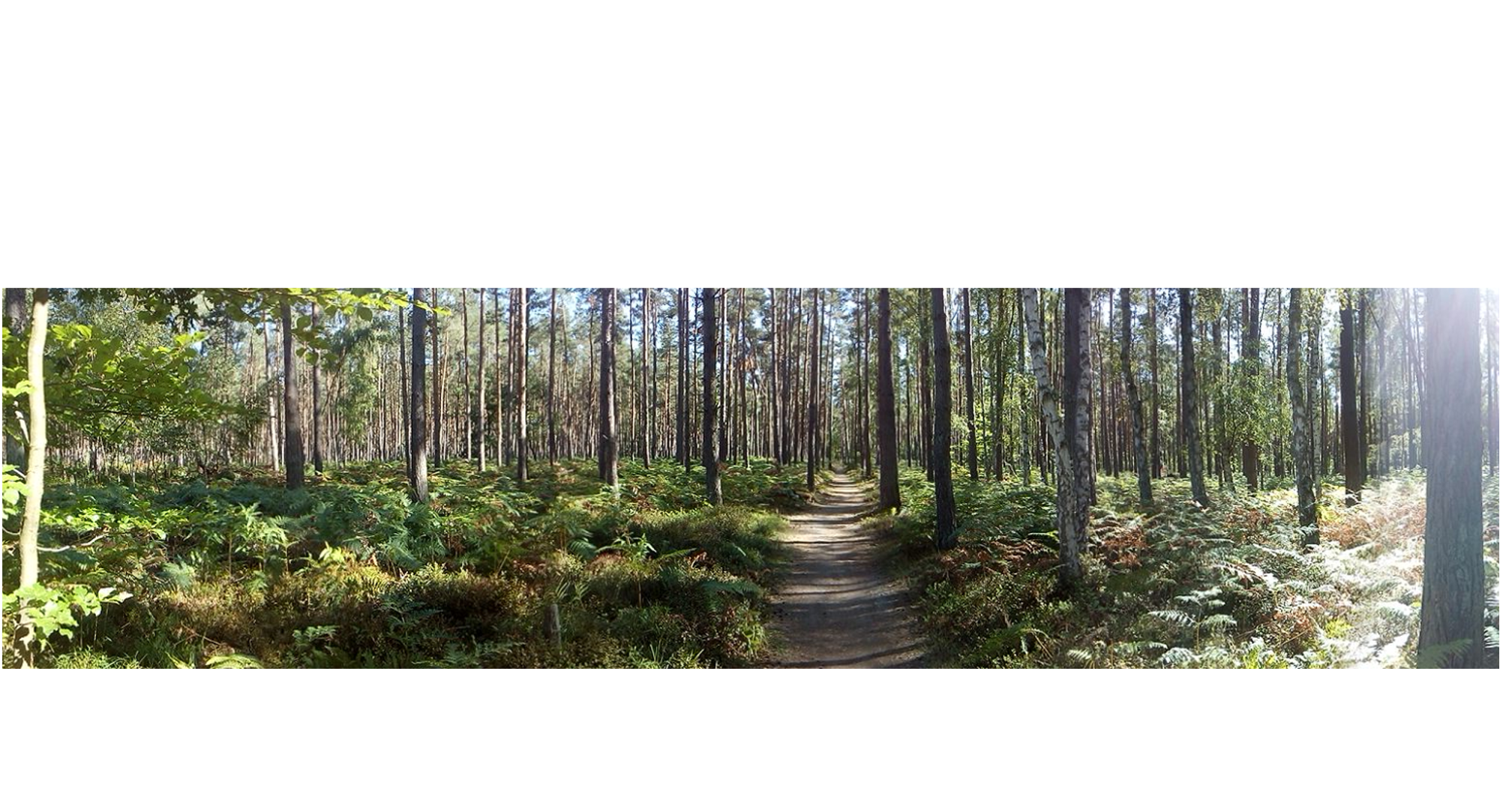Mein Erlebnis der Lesung von Herta Müller am 27.11.2014 in der Alten Aula der Marbuger Philipps-Universität
Ich war zuerst nicht sicher, ob ich hingehen sollte. Eine Nobelpreisträger*in liest in der förmlichen und traditionsüberlasteten Atmosphäre der Alten Aula der Marburger Philipps-Universität aus ihren Werken. Vor meinem inneren Auge figurierten die Honoratioren unseres mittelhessischen Städtchens in Abendgarderobe in dunklen Farbtönen, ein steifes und irgendwie unangenehm bleiernes Gefühl erfasste mich bei dem Gedanken. Ich ging trotzdem hin, denn ich interessiere mich für Dissidenz. Und, obwohl mein inneres Auge hinsichtlich der honorablen Atmosphäre prophetische Kompetenzen beweisen sollte (ich kam zu allem Überfluss auch noch auf einer harten, mittelalterlich anmutenden, aber vermutlich aus deutschnationalen Gründen im wilhelminischen Kaiserreich genau so geschreinerten Holzbank zum Sitzen), wurde ich von Herta Müller für die Erduldung dieser Peinlichkeiten tausendfach belohnt.
Durch ihre im Rumänien der Ceaucescu-Diktatur veröffentlichten Texte geriet sie ins Visier der Securitate, des allgegenwärtigen Geheimdienstes der sozialistischen Repressionsmaschine. Immer und überall unter Beobachtung, in Angst vor Spitzeln und politischem Mord, schrieb sie, auch in der Fabrik, in der sie arbeitete, nach ihrer Ächtung gezwungenermaßen auf der Treppe der Fabrik, bloßgestellt.
„Die Texte waren etwas, was du selbst bestimmt hast. Das war ein Stückchen richtiges Leben im falschen.“ Skurilerweise, so erzählt Herta Müller, sei die Diktatur ein gutes Umfeld für Literatur gewesen. Alle, auch die einfachen Arbeiter*innen in der Fabrik, kannten Gedichte auswendig, weil sie sie brauchten, um dem mörderischen Druck der Repression einen inneren Widerstand entgegenzusetzen. Und die Texte, die die Menschen dazu auswählten, an die sie sich erinnerten, seien gute Literatur gewesen. Die Nobelpreisträger*in erklärt das so:
„In Situationen, die Angst erzeugen, halten nur Texte stand, die dicht sind, die dich beruhigen, dich nicht täuschen.“
Als sie es schafft, nach Deutschland auszureisen, wird sie erstmal tagelang vom BND verhört. Die Landsmannschaft der Banater Schwaben in Rumänien, von Securitate-Spitzeln unterwandert, habe, so Müller, sie vermutlich beim BND als Securitate-Spionin verleumdet, und „diese Deppen haben denen geglaubt. Ich habe gedacht, die Welt ist entgleist.“
Als es schließlich um ihren rechtlichen Status in Deutschland geht, übertreffen sich die deutschen Behörden selbst. Herta Müller: „Sie haben gesagt: `Sie müssen sich schon entscheiden: Entweder sind sie Deutsche oder politisch verfolgt, beides zusammen geht nicht. Dafür haben wir keine Formulare.‘ “ Die Dichter*in antwortete: „Dann geben sie mir zwei.“
Gegen ihre Vereinnahmung als Heimatdichter*in wendet sie sich dezidiert: „Heimat braucht man nicht. Man hat einen Kleiderschrank und Freunde.“ Wie brüchig Freundschaften in einer von Spitzeln vergifteten Zeit aber sind, davon gibt ihr Text „Der Fuchs war damals schon der Jäger“ Zeugnis, aus dem sie vorträgt: Ihre einzige Freund*in in der Fabrik in Rumänien, Teresa, die sich trotz Müllers Ächtung und Isolation zu ihr zum Essen auf die Treppe der Fabrik gesetzt hat, als es noch gefährlich war, zu ihr zu stehen, besucht sie später in Deutschland. Herta Müller schöpft Verdacht, findet in Teresas Koffer ein Duplikat des Wohnungsschlüssels zu Müllers Wohnung, zusammen mit einer Telefonnummer. Sie ruft an, hört: „Rumänische Botschaft“. Sie weiß: Teresa ist vom Geheimdienst auf sie angesetzt worden. Später erfährt sie, dass Teresa zu dem Zeitpunkt auf den Tod krebskrank war, die Securitate hat ihre Verzweiflung ausgenutzt.
Müller plädiert trotz aller in ihren Worten immer mitklingenden Wut und Empörung für differenziertes Beurteilen. So sei zwar Oskar Pastior auch als Spitzel für den Geheimdienst aktiv gewesen, er sei aber in einer verletzlichen Position gewesen, weil 7 Gedichte über das russische Lager, in das er deportiert worden war, gefunden wurden und er mit Haft bedroht wurde, außerdem habe er innerhalb von 10 Jahren nur 7 harmlose Berichte an den Geheimdienst abgeliefert. Nützliche Spitzel hätten mindestens alle 2 Wochen einen Bericht geschrieben.
Abschließend ein paar Worte zu den beklemmenden Aspekten des Ortes der Lesung. Im Grußwort sagte die Präsidentin der Philipps-Universität Marburg, Krause: In diesem Saal, mit so vielen äußeren Bildern, werde es Herta Müller sicher nicht schwer fallen, auch innere Bilder hervorzurufen. Ich schaute mir daraufhin eines der Bilder, die die Wände der ehrwürdigen Alten Aula der Marburger Universität mehr bedecken als schmücken, etwas näher an. Das, unter dem ich saß, zeigt in historistischem Stil laut Bildunterschrift in Fraktur folgendes: „Friedrich II verabschiedet Deutschordensritter nach Preußen.“ Angeblich spielte sich die dargestellte Szene im 13. Jahrhundert ab. Kreuze auf dem Waffenrock zeigt das Bild nicht. Dazu muss man wissen, dass es in Marburg eine Niederlassung des Deutschritterordens gab. „Diese Aula ist einfach ein Zeugnis der Konstruktion deutschnationaler Identität“, dachte ich. Danke an den feinsinnigen und musisch interessierten Kaiser Friedrich II (den mittelalterlichen) für die frühe Akquise von Lebensraum im Osten. Dass besagter Friedrich II., obschon deutscher Kaiser, die meiste Zeit seines Lebens in Sizilien weilte und sich bei mediterranem Sonnenschein am Wein und der feinen Kultur des Mittelmeerraums mit ihren arabischen Einflüssen ergötzte, scheint den Maler des Bildes und seine universitären Auftraggeber nicht so interessiert zu haben. Die Deutschordensritter hätte ich an Friedrichs Stelle aber auch lieber nach Preußen zum Morden und Brandschatzen geschickt, statt sie auf meine Party am Gestade Siziliens einzuladen, wo sie grob die ortsansässigen Schönheiten begrapscht hätten.
Ich bin um jedes Wort froh, das Herta Müller an diesem Abend gesprochen hat. Die inneren Bilder, die sie in mir hervorgerufen hat, waren wesentlichen wahrer als die äußeren Bilder in der Alten Aula der Marburger Universität. An der Alten Aula war vor allem eines sehr wahr: Die Härte der deutschnationalen Holzbank, auf der ich saß, nur leicht gemildert von einem dünnen Sitzkissen, vermutlich während der Bildungsexpansion der 1960er und 70er Jahre angeschafft. Gerade dick genug, um Herta Müller vom ersten bis zum letzten Wort aufmerksam zuhören zu können.