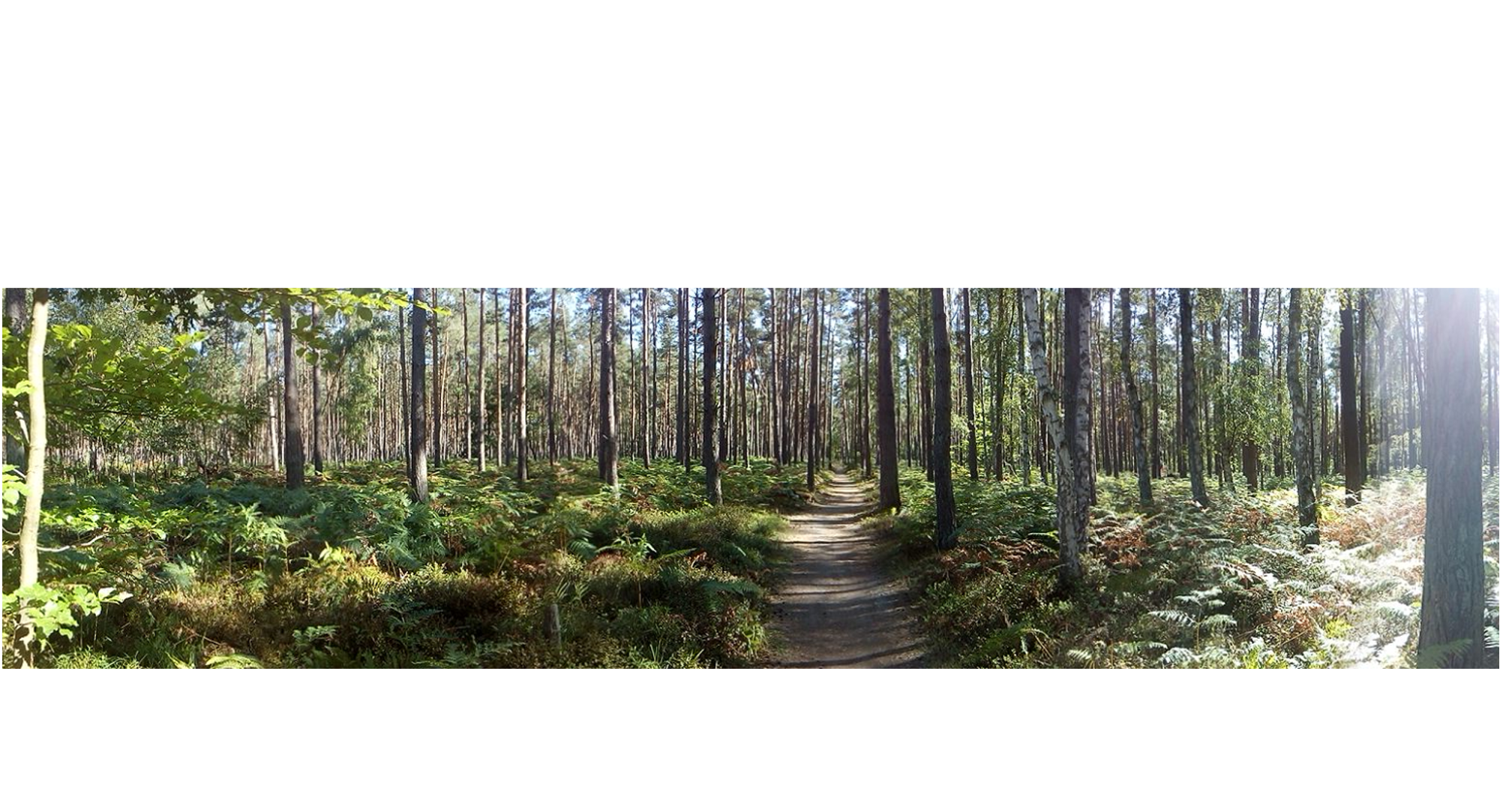Ich saß vor einiger Zeit mit meinem guten Freund und Mitphilosophen Daniel in einem philosophischen Vortrag, in dem es unter anderem um Selbstverwirklichung ging. Ich habe Daniel, um den Vortragenden nicht zu stören, auf meinen Zettel geschrieben: „Wieso Selbstverwirklichung? Ich bin doch schon wirklich.“ Daniel schrieb mir eine lange Antwort und verteidigte das Konzept der Selbstverwirklichung. Das ist jetzt in doppelter Weise interessant: 1., weil man daran sieht, dass sich auch erwachsene Philosophen manchmal wie 16jährige Schüler verhalten, und 2. weil Daniel und ich oft einer Meinung sind, und dass wir beim Thema Selbstverwirklichung nicht übereinstimmen, weist darauf hin, dass es sich um ein interessantes philosophisches Problem handelt.
Deshalb denke ich jetzt auch schon seit einigen Jahren darüber nach, und jetzt ist mir etwas aufgefallen: Ich glaube, mein Problem mit dem Begriff Selbstverwirklichung ist nicht so sehr das, was Axel Honneth und andere Philosoph*innen und Soziolog*innen an dem Konzept und seiner sozialen Realität kritisieren, dass wir nämlich in Zeiten bloß scheinbarer Selbstverwirklichung leben: Viele Menschen arbeiten auf „Projektsstellen“ oder in eigenen Start-Up-Mini-Firmen im neoliberalen Kapitalismus, was ihnen scheinbar kreative Freiräume bietet, leider aber real Ausbeutung und Fremdbestimmung und Unsicherheit bedeutet. Diese „Flexibilisierung“ ist ein Weg, eine ganze Klasse von Menschen, die eigentlich von Fremdbestimmung die Schnauze voll haben, zu integrieren und auszunutzen. Mein Problem mit dem Konzept ist auch nicht in erster Linie, dass es unter dem Deckmantel scheinbarer Freiheit Leute zwingt, sich selbst ständig zu verbessern, eben Selbstoptimierung zu betreiben und sich so selbst der schlimmste Disziplinierer sein zu müssen, vor dem es kein Entrinnen gibt.
Mein Problem ist, dass Selbstverwirklichung ein sehr reduziertes Konzept menschlicher Freiheit ist, und andere Formen menschlicher Freiheit darüber vergessen werden. Das Konzept lässt sich so zusammenfassen: Ich habe Wünsche, wer und wie ich sein will und was ich in der Welt erreichen will, ob das jetzt ist, als hipper Grafikdesigner die IT-Welt zu revolutionieren oder als Ärztin in Nigeria unter Lebensgefahr Leute vor dem Malariatod zu retten. Und diese Wünsche will ich in die Wirklichkeit umsetzen. Das nenne ich dann: „Ich habe mich selbst verwirklicht.“ Das ist sozusagen ein kreatives Verhältnis zur eigenen Identität: Ich habe eine Idee von mir, und die will ich umsetzen. Das ist vergleichbar mit Sartres existenzialistischem Konzept, demzufolge wir Menschen „zur Freiheit verurteilt“ sind. Wir müssen uns selbst definieren, einen „Entwurf“ von uns machen und den dann zur Orientierung in unserem Leben benutzen.
Das ist auch alles schön und gut. Das Problem ist aber, dass ich ja schon längst jemand war, bevor ich mir einen Entwurf gemacht habe, wer ich sein will. Ich bin in einer bestimmten Familie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten gesellschaftlichen und politischen Situation geboren, und das ist Teil meiner Identität, ohne dass ich auch nur einen Mucks dazu zu sagen hatte, ob ich diese Identität haben wollte oder nicht. Und nur exzessiver und anhaltender Drogengebrauch, eine Wahrnehmungsstörung oder eine Massenpsychose können mich dauerhaft darüber hinwegtäuschen, dass ich eben nicht alle meine Eigenschaften kreativ verändern, ablegen und mir auch nicht beliebig viele neu aneignen kann.
Das wäre jetzt für die Selbstverwirklichung etwa im Sinne von Peter Bieris Handwerk der Freiheit kein Problem, weil es in seinem Konzept reicht, wenn ich mich ein bisschen selbst gestalten kann, darin liegt dann eben die begrenzte Freiheit, die wir haben.
Aber ich denke, dass auch dies ein ausgesprochen reduktionistisches Verständnis von Freiheit ist, weil für mich Freiheit eben auch und in erster Linie bedeutet, das ich all das ausleben kann, was ich mir zwar nicht bewusst selbst ausgesucht habe, was aber trotzdem Teil meiner Identität ist. Ich habe eine Reihe von Gefühlen, Gedanken, Bedürfnissen und Wünschen, die habe ich mir nicht ausgedacht und mir auch nicht gewünscht, zum Beispiel das Bedürfnis, mich dann und wann ordentlich zu besaufen. Und den tiefempfundenen Wunsch, mein Leben lang faul zu sein, und trotzdem reich. Ich weiß selbst, dass das einem Ethiklehrer nicht gut zu Gesicht steht. Aber wenn ich nicht solche Wünsche wenigstens manchmal ausleben kann, dann fühle ich mich wie im Knast, und da hilft mir auch die ganze vielgepriesene Selbstverwirklichung nicht, weil Freiheit eben auch und vor allem darin besteht, dass ich wenigstens zeitweise ich selbst sein kann, wie ich bin, und Punkt. Und dass mein soziales Umfeld das akzeptiert, auch wenn es manchmal nervt.
Peter Bieri würde mich in solchen Momenten dann vermutlich mit Harry Frankfurt einen „Wanten“ nennen, ein Wesen, das seinen eigenen Wünschen willenlos ausgeliefert ist. Und ich denke ja auch, dass es überlebenswichtig für mich ist, dass ich meinen Wunsch, faul zu sein, mit meinem Willen kontrollieren kann, damit ich nicht irgendwann meinen Job verliere und auf dem Schrottplatz ackern muss.
Trotzdem gehört zu meiner Freiheit nicht nur, dass ich mich bewusst selbst kontrollieren kann, sondern auch, dass ich manchmal tue, was ich mir gerade wünsche und mich so im Einklang mit mir fühlen kann, und zwar egal, ob das meinem Ideal von mir entspricht, oder nicht, und auch egal, ob das jetzt eigentlich gut für meine persönliche Entwicklung und meine Lebensziele und die Person ist, die ich in 20 Jahren sein werde. Denn eins steht fest: Wenn ich dauernd mit meiner eigenen Selbstverwirklichung beschäftigt bin, werde ich in 20 Jahren eine Art innere Zwangsjacke tragen und mich gar nicht mehr erinnern, wie es war, sich frei zu fühlen. Da tröstet es dann wenig, wenn ich durch ständiges Feilen und Polieren an meiner Identität ein facettenreiches Juwel in der Galerie menschlicher Persönlichkeiten geworden sein sollte. Ich glaube, ich mach erstmal Pause, das war jetzt alles so anstrengend.