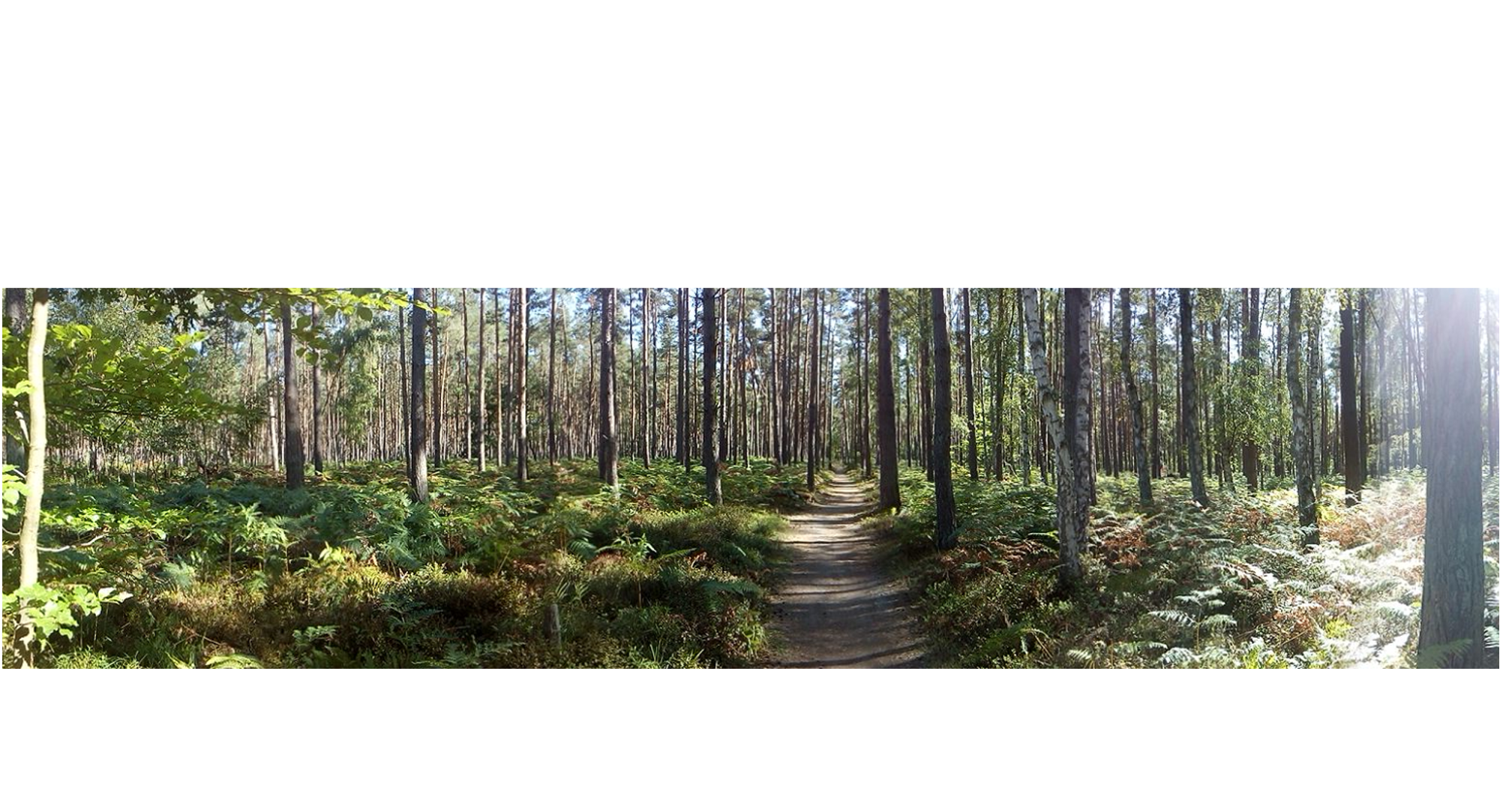Adorno schreibt, der Kapitalismus bedrohe uns auch deswegen, weil in seinen Strukturen jedes menschliche Wesen austauschbar sei – fungibel. Ich glaube, der Individualismus ist der Versuch, auf die Angst davor, einfach ausgetauscht zu werden, eine Antwort zu finden. Leider stellt sich das kapitalistische System sehr gut auf diese Strategie ein und ihr Resultat ist eher mehr Angst als weniger.
Judith Butler schreibt in „Die Macht der Gewaltlosigkeit“, dass der Individualismus Teil eines politischen Phantasmas sei, in Wirklichkeit existierten alle Menschen in gegenseitiger Abhängigkeit – von Anfang an und für immer.
Simone Weil hat sozusagen die aktive Seite dieser Beziehungen betont – indem sie geschrieben hat, dass alle Menschen das Bedürfnis haben, von anderen gebraucht zu werden. Wird dieses Bedürfnis nicht erfüllt, zum Beispiel, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren. entsteht Entwurzelung.
Entwurzelung führt zu Angst, und meine These ist, dass die Individualisierung der letzten Jahrzehnte eigentlich den Versuchen von vielen Menschen entspricht, diese Angst zu bewältigen. Die Strategie sieht einfach so aus, sich so gründlich und auf vielen Ebenen von anderen Menschen zu unterscheiden, in Habermas Worten: so einzigartig zu sein, dass ich einfach nicht ersetzbar bin, weil es niemanden gibt, der alle die Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringt, die mir meine soziale Position sichern – auf der Arbeit, im Geflecht meiner sozialen Beziehungen, privat oder politisch.
Leider ist das kapitalistische System sehr anpassungsfähig, und da es in der Logik des Systems liegt, Menschen möglichst austauschbar zu gestalten, weil nur so Druck auf Menschen ausgeübt werden kann, Arbeit anzunehmen und die Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, wie das System sie vorgibt, hat der Kapitalismus viele Lösungen gefunden, wie zum Beispiel Projektstellen in der Wissenschaft und in den großen Konzernen, die zeitlich begrenzt sind und zwar ein ganz bestimmtes Profil der Bewerber*innen verlangen, aber eben nach 3 Monaten oder 3 Jahren auch zugunsten neuer Stellen mit neuen Profilen einfach wieder verschwinden können. Oder wie die Ich-Ags und die Kleinselbständigkeit, die viele Menschen abhängig von einem sich dauernd wandelnden Markt machen. Axel Honneth hat das in „Paradoxien der Individualisierung“ beschrieben.
Paradoxerweise ist es daher, vor allem in gewinnträchtigen und machtbesetzten Positionen, jetzt schon so, dass Individualismus die neue Norm ist, und Menschen sich nicht mehr entscheiden können, sich zuerst durch ihre Gleichheit mit anderen und ihre Beziehungen zu anderen zu definieren. Wenn wir versuchen, dieser Norm zu folgen, wissen wir aber nie, ob wir erfolgreich sind, oder ob unser individueller Entwurf schon nächstes Jahr nicht mehr ökonomisch verwertbar sein wird – die Angst, ausgetauscht zu werden, kehrt also zurück. Durch unsere mühsam ausgefeilte und entwickelte Einzigartigkeit entstehen aber zugleich immer mehr Konflikte mit den Menschen in unserem Leben, weil unser Individualismus es schwerer macht, sich zu einigen, Konsense zu finden, etwas gemeinsam wertzuschätzen und gemeinsam zu entscheiden. Die Angst verdoppelt sich, weil unsere Beziehungen gestörter sind und trotzdem keine ökonomische Sicherheit herausspringt.
Inidvidualismus ist also keine Lösung für unsere Angst und für das Problem der Entwurzelung. Was ist die Alternative? Wir sollten unsere Gruppen und unsere Solidarität stärken. Ich denke, wir können unsere Einzigartigkeit behalten und gegen den Kapitalismus einsetzen, indem wir Gruppen bilden, in denen wir uns gegenseitig ergänzen und stark machen, indem alle das einbringen, was ihre Einzigartigkeit ausmacht. Das ist allerdings auch die Botschaft vieler Superheld*innen-Blockbuster, wie zum Beispiel X-Men, in denen Teams gerade dadurch gewinnen, dass sich die einzelnen Superheld*innen gegenseitig ergänzen. Das ist eher ein Hinweis darauf, dass ich mich Rahmen der kapitalistischen Narrative bewege. Also bin ich wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Vielleicht müssen wir in unserer gegenseitigen Solidarität anerkennen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was zukunftsträchtige Stärken und wichtige Fähigkeiten von Personen sind – und dadurch unsere Solidarität entgrenzen. Es kann sein, dass ein Wesen überhaupt nichts kann, außer uns beizubringen, wie wir die eigenen Bedürfnisse zurückstellen können, ohne psychisch zu verhärten – und sich gerade das in 20 Jahren als der wichtigste Lernprozess für eine zukunftsfähige gemeinsame Lebensform herausstellt. Wir sollten also unsere Solidarität nur sehr lose an unsere Vorstellungen davon knüpfen, was wertvoll ist. Die Definition von Solidarität, die Axel Honneth in „Der Kampf um Anerkennung“ 1992 als dritte Form der Anerkennung in sozialen Bewegungen verortet hat, ist deshalb nicht hilfreich. Unsere Solidarität kann sich nicht darin erschöpfen, die Anerkennung von Personen aufgrund einer wertvollen Leistung zu sein. Echte Solidarität muss diese Grenze überschreiten und unser Nicht-Wissen darüber reflektieren, was eigentlich wertvoll sein wird, welche Werten wir vertrauen werden, wenn wir weiter nachgedacht haben werden und unsere Gesellschaft sich verändert haben wird. Unsere Solidarität muss dafür sensibel sein, dass wir auch hier auf dünnem Eis gehen.