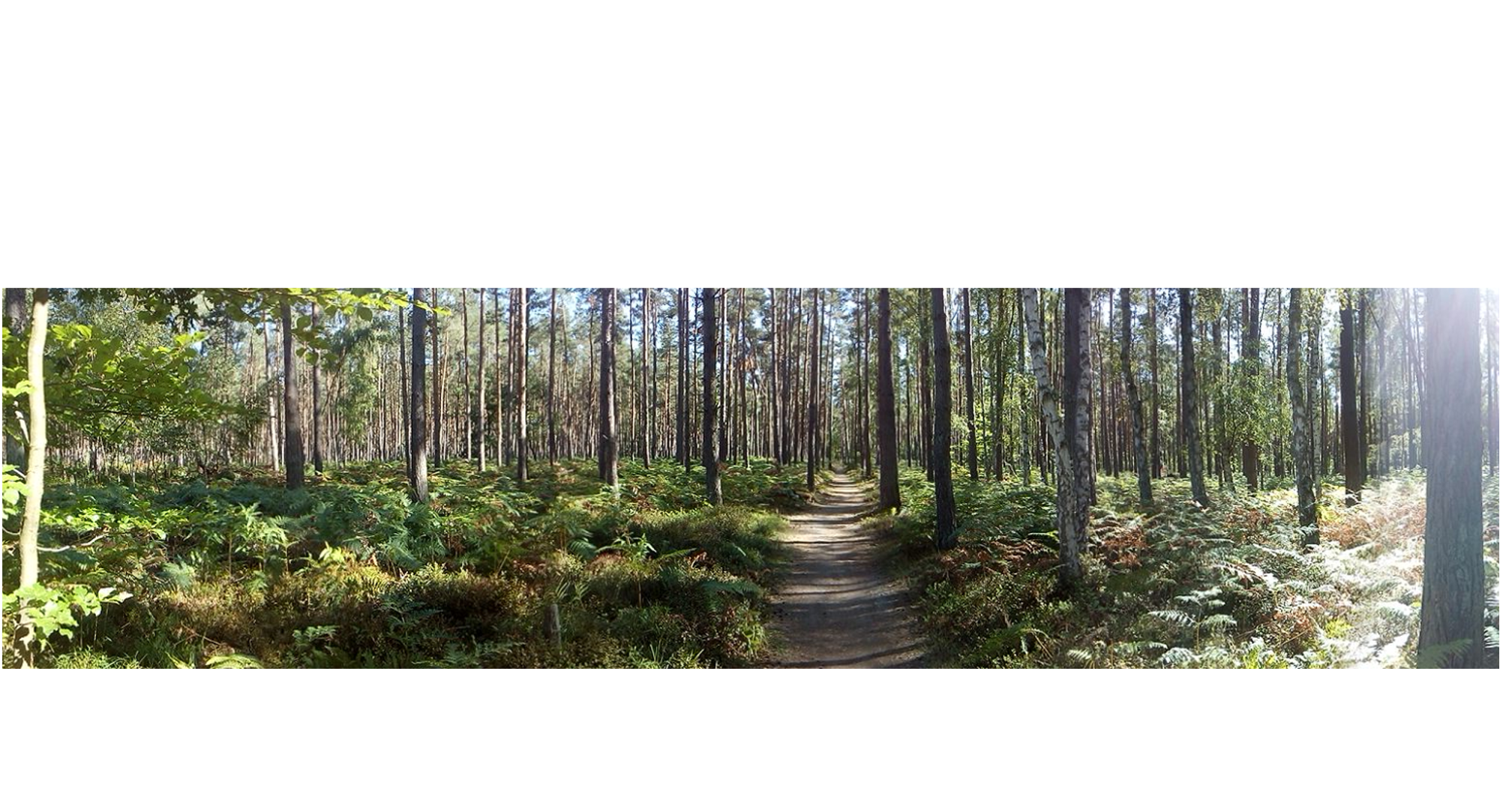Ich versuche, mich an das erste Lied zu erinnern, dass ich in meinem Leben gehört habe: Das erste, was mir einfällt, ist „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, das war in einem Liederbuch, das in meiner Erinnerung sehr groß und dick und weiß mit schönen Zeichnungen zu vielen Liedern ist, und da konnte ich auch die Gans sehen. An den Fuchs erinnere ich mich nicht (das kann daran liegen, dass, wie Hans Rosling schreibt, unser Nervensystem die negativen Erinnerungen wegsubtrahiert, deshalb glauben wir, dass früher alles besser war, und je länger es her ist, desto besser erscheint es uns dann auch).
Meine Mutter hat mir, als ich 4 oder 5 war, auf der Querflöte die Lieder aus dem Buch vorgespielt, ich erinnere mich auch an „Hänschen klein“, das fand ich traurig.
Das erste Mal bei einem Lied in Tränen ausgebrochen bin ich dann, als ich mit etwa 7 den Abspann von einer Folge „Lucky Luke“ gesehen habe, in dem er auf Jolly Jumper in den Sonnenuntergang reitet und singt „I am a poor lonesome Cowboy, far away from home…“. Meine Mutter musste mich trösten, sie hat ganz erschrocken gefragt, warum ich denn so traurig sei, und ich konnte das nicht so richtig beantworten, ich habe nur irgendetwas geschluchzt, an dass ich mich leider nicht erinnern kann.
Ich kann nicht sagen, ob ich Bilder und Musik zusammen als Kind eindrücklicher fand als Musik ohne Bilder, oder ob meiner Erinnerung sich diese Kombination nur besser eingeprägt hat. Klar ist allerdings, dass meine Mutter eine wichtige Rolle bei meinen ersten Musikerlebnissen spielte. Sie hat uns Geschwistern auch die Kassette „Die Rübe“ gekauft, die ich glaube ich immer noch habe. Da war drauf: „Der Cowboy Jim aus Texas“ (der nachts auf seinem Pferd saß, hat einen Hut aus Stroh, und darin sitzt ein Floh…ich kanns immer noch im Kopf mitsingen: Yippie Yei, Yippie Yeiei, Yippie YeiYeiYeiYeiYei). Ich glaube, Benjamin hätte seinen Aufsatz über die technische Reproduzierbarkeit von Kunstwerken nochmal umgeschrieben, wenn er die Nazis überlebt und gesehen hätte, dass Kinder in den 1980er Jahren unermüdlich immer dieselben Kassetten nochmal und nochmal hörten.
Es wird wahrscheinlich die Herausforderung meiner Generation, mit den nächsten klarzukommen, die schon mit Spotify und einem unmittelbar zugänglichen Pluriversum von Musik aufwachsen und, wenn sie nicht wollen, keinen Song mehr als einmal hören müssen.
Der Titelsong der Rübe brauchte nun gar kein visuelles Bild, um sich mir einzuprägen, der Text reichte, weil ich mir die Gruppe Kinder, die zusammen an einer riesigen Rübe ziehen und sie auch nur zusammen mit den italienischen Nachbarskindern rausgezogen bekommen können, so in einem inneren Bild ausmalte, als hätte ich daneben gestanden. Ich hatte das Glück, später mit 14 mit einem Freund, der eine italienische Mutter hatte, am Lagerfeuer zu singen, und er war wahrscheinlich der wichtigste Gesangslehrer, den ich jeh hatte – er weiß nichts davon. Das kommt auch sehr viel später auf dieser Tonspur. Aber vielleicht hat die Rübe dieser Freundschaft, die bis heute besteht, schonmal den Weg geebnet.