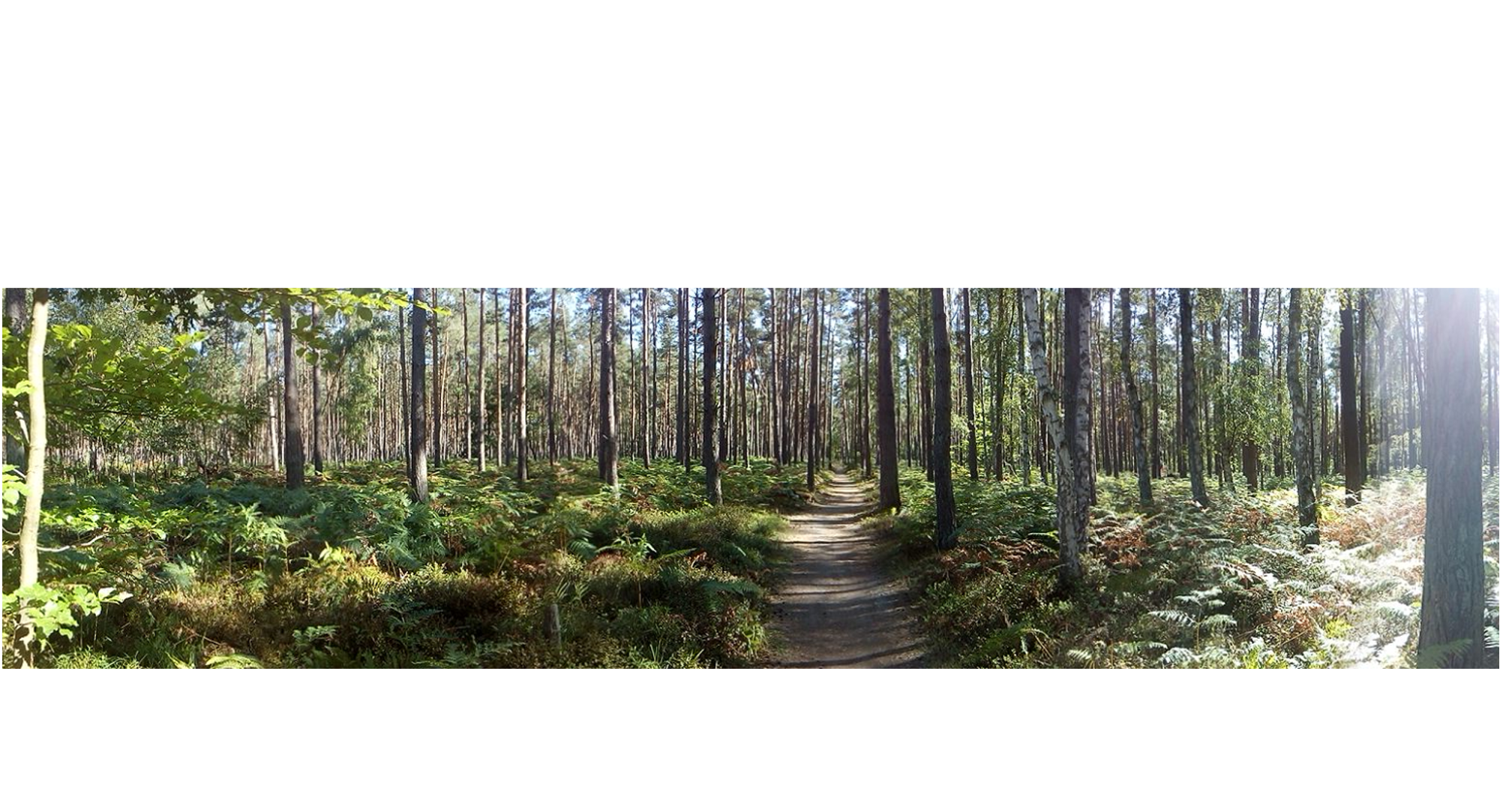Die Finanzkrise jagt uns Angst ein. Da ist die Versuchung groß, zugleich Schuldige zu benennen und das Problem an der Wurzel zu packen, damit das nicht wieder passiert. Wenn beides, die Schuldigen haftbar zu machen und das Problem an der Wurzel auszurotten, gleichzeitig geht, sind wir geneigt, sofort „ja“ zu brüllen, damit wir es hinter uns haben und das Nötige getan ist.
Auf der Demonstration „Banken in die Schranken“ in Frankfurt im Dezember 2011 gaben viele dieser Versuchung nach. Der Kabarettist Georg Schramm prangerte unter Applaus den Zinswucher als die Wurzel allen Übels an und hätte wohl auch gerne die Banker wie am mittelalterlichen Pranger vor aller Augen erniedrigt gesehen. Unter wieviel Applaus auf einer linksorientierten Demonstration ein mittelalterlicher Papst zitiert werden kann, weil er den Zinswucher verdammt hat, das ist erstaunlich.
Noch erstaunter war ich, als ich auf der Rückfahrt mit einem Freund und Mitdemonstranten in Streit geriet, weil er auch der Überzeugung ist, dass der Zins ein zentrales Problem des Kapitalismus ist und eine zinslose Geldwirtschaft viel Ungerechtigkeit beseitigen würde, weil niemand mehr vom bloßen Besitz eines großen Geldvermögens leben könnte, während andere hart für ihr Geld arbeiten müssen. Ich bin da anderer Meinung.
Der Zins ist nicht das Problem. Die Gier der Banker auch nicht. Wer das glaubt, hat einen gedanklichen Kurzschluss. Berechtigte Angst und Wut haben da einige synaptische Umwege abgekürzt. Folgen wir kurz solchen Umwegen.
Ein altertümliches Wort, das viele von uns in einem Vertrag unterschrieben haben, lautet: „Mietzins“. Ich zum Beispiel zahle für mein Zimmer etwa 240 Euro Mietzins monatlich. Mein Vermieter überlässt mir einen Teil seines Eigentums, und ich entrichte ihm Zinsen dafür. Jetzt kann man mit guten Gründen sagen, dass das Wohneigentum in unserer Gesellschaft ungerecht verteilt ist, dass Spekulanten mit überhöhten Mieten die Mieter ausbeuten und dass eine Gesellschaft, in der alles Wohneigentum in öffentlicher Hand wäre, viel besser wäre. Wenn da nur nicht mein Vermieter wäre. Er hat bloß dieses eine Haus, das viel zu groß für ihn und seine Frau ist, und er ist ein netter Kerl. Ich denke, er wäre nicht so begeistert davon, wenn er enteignet würde, damit ich für mein Zimmer keine 240 Euro Mietzins mehr zahlen müsste. Ich überlege mir nun, was ich an seiner Stelle tun würde, wenn ich Eigentümer dieses Hauses wäre, und ob ich den zwei anderen WGs und meinem Vermieter und seiner Frau ihre Wohnungen mietzinsfrei überlassen würde. Ich denke nicht. Und ich glaube auch nicht, das Georg Schramm und die anderen Zinsgegner das tun würden.
In einer Republik, in der es ein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf Eigentum gibt, wäre es ökonomisch gesehen fatal, wenn jede Form, Eigentum anderen zur Nutzung zu überlassen und dafür Gegenleistungen in Form von Geld zu verlangen, abgeschafft würde. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Mietzins für Wohneigentum, Zinsen für geliehenes Geldkapital oder die Miete für eine Schleifmaschine oder ein Auto handelt: Das Prinzip ist das gleiche. Es ermöglicht, dass ich in den Baumarkt gehen kann und mir eine Dielenschleifmaschine für 90 Euro leihen kann, die ich nur ein- bis zweimal in meinem Leben brauchen werde, weshalb ich sie mir nicht kaufen will. Sie zu kaufen lohnt sich aber auch für den Baumarkt nur, weil er von mir Miete dafür nehmen kann.
Zins ist ein Grundprinzip einer Ökonomie, die auf Privateigentum basiert. Dieses Prinzip ist ökonomisch sinnvoll, weil nicht immer der, der etwas braucht oder nutzen will, es auch als Eigentum erwerben kann oder will. Ich will mein Recht auf Privateigentum nicht abgeben. Ich will aber Dinge nutzen, die mir nicht gehören, wie eine Wohnung und die Bahn. Also muss ich wohl mit irgendeiner Form von Zins leben.
Man kann meinen subjektiven Unwillen, mein Privateigentum abzugeben, als Argument zurückweisen, indem man diesen Unwillen als krankhafte, durch die Lebensbedingungen im Kapitalismus verursachte Störung meiner Psyche deutet. Ich halte dem entgegen, dass ich das Recht auf Privateigentum als zentralen normativen Bestandteil einer freien Organisation von Gesellschaft begreife. Ich denke, dass eine Bedingung für eine solche Organisationsform ist, den Menschen die Wahl zu lassen, ob und wieweit sie sich individualistisch oder kollektivistisch verhalten. Ich zum Beispiel bin froh, viele Entscheidungen alleine und ohne Rücksprache mit anderen treffen zu können und nicht alle Bereiche meines Lebens komplexen kollektiven Entscheidungsprozessen unterwerfen zu müssen.
Die Grenze vom akzeptablen Zins zum Zinswucher ist aber sicher fließend. Gerade in Bereichen, in denen es keinen transparenten Markt gibt, der dem Entleiher einen realistischen Vergleich der Leihbedingungen ermöglicht, wird Zinswucher begünstigt, ebenso auf Märkten, auf denen es zu einer Konzentration von Marktmacht gekommen ist, die Konkurrenz unter Verleihern ausschaltet. Beides ist im Falle des Geldmarkts im Moment der Fall. Das bedeutet, dass hier die politische Öffentlichkeit per Gesetz klare Grenzen ziehen muss, die verhindern, dass sich die Gesellschaft in eine Klasse von wenigen reichen Besitzenden, die durch die Zinsen für ihr Eigentum immer reicher werden, und eine Klasse von vielen Besitzlosen, die im Elend leben, weil sie zum Beispiel die Mietzinsen kaum noch mit ihrem Arbeitslohn zahlen können, aufspaltet.
Der Titel der Demonstration hieß deshalb ja auch nicht „Banken enteignen“, wie es die Linke fordert, sondern „Banken in die Schranken“, womit klare gesetzliche Grenzen für Geschäfte gemeint sind, in denen mit Geldeigentum noch mehr Geldeigentum erwirtschaftet wird. Ganz nüchtern betrachtet sind solche Grenzen keine bloß humanistische Möglichkeit, mit der man den Kapitalismus menschenfreundlicher machen kann, sondern sie sind wegen ihres humanitären Effekts einfach notwendig, um den Kapitalismus und die Demokratie langfristig zu erhalten. Denn wenn die Mehrheit im Kapitalismus kein menschenwürdiges Leben führen kann, weil Eigentum zu ungleich verteilt ist, wird sie den Kapitalismus sowieso abschaffen, es sei denn, der Kapitalismus schafft vorher ihre demokratischen Rechte ab.
Ich komme zum zweiten Wunsch, der uns durch Angst und Wut eingegeben wird: Den Wunsch, Schuldige zu finden und zu bestrafen. Eins ist ja klar: Wir, die wir in Frankfurt demonstriert haben, können nicht schuld sein. Wir haben viel zu wenig Einfluss auf den Finanzmarkt, um schuld sein zu können, weil wir so wenig Geldeigentum haben und so gut wie keinen Einfluss auf die Wege, auf denen die großen Mengen des Geldkapitals gegen Zinsen verliehen werden.
Das Ohnmachtsgefühl, das uns befällt, ist ja teilweise realistisch. Die Finanzkrise fühlt sich für mich wahrscheinlich ein bisschen so an, wie sich für einen mittelalterlichen Bauern eine Dürre- und Hungerperiode in einem Nachbarland angefühlt hat: Mir geht es eigentlich noch gut, aber ich weiß, dass ich keinen Einfluss darauf habe, ob es mich im nächsten Jahr genauso trifft wie meine Nachbarn. Im Mittelalter haben viele, um ihrer Hilflosigkeit und ihrer Ohnmachtsgefühle Herr zu werden, die Juden für solche Notsituationen zu Sündenböcken gemacht. Man erklärte sich so, warum rechtschaffene fromme Christen mit Hunger und Dürre gestraft wurden, obwohl Gott doch barmherzig und gerecht ist, genau wie der König, der von Gottes Gnaden regiert.
Heute ist die Situation so ähnlich, und doch anders. Wir wollen genauso von zwei Ideen nicht ablassen: Wir wollen einerseits glauben, dass Privateigentum im Grunde eine gute Sache ist und der Kapitalismus das Leben mit den Jahren immer lebenswerter macht. Andererseits wollen wir glauben, dass unsere demokratischen Gemeinwesen vernünftig organisiert sind. Die Finanzkrise macht jetzt offensichtlich, dass dieser Glaube nicht ganz wahr sein kann. Um diese Evidenz abzuwehren und unser Weltbild zu erhalten, brauchen wir Schuldige: Diesmal sind es nicht die Juden, sondern die Banker und Hedgefondsmanager. Wenn sie schuld sind, können wir unser Wohneigentum und unsere kleinen Vermögen behalten und weiter alle vier Jahre die Bundesregierung wählen, ohne dass wir den Kapitalismus und die Demokratie zusammen mit unserem eigenen, diese Systeme erhaltenden Handeln in Frage stellen müssen.
Jetzt ist es nicht mehr ganz so wie im Mittelalter, denn wir müssen die Regierungspartei nicht wieder wählen und wir müssen unser Geld nicht durch die deutsche Bank verwalten lassen. Wenn das massenweise Menschen trotzdem tun, dann sind sie mitverantwortlich für die Finanzkrise. Auch ich sitze mit den Managern und Bankern und der Bundesregierung im selben Boot, obwohl ich in eine andere Richtung rudere als sie, indem ich andere Parteien wähle und mein Geld bei der Sparkasse investiere. Im Gegensatz zu der Auffassung, dass die Finanzkrise auf die Machenschaften von einigen wenigen Schmarotzern an einer sonst gesunden Gesellschaft zurückgeht, bin ich der Auffassung, dass der Wahnsinn der Ausbeutungs- und Krisengesellschaft schon beim politischen und privaten Handeln von jedem von uns anfängt. Die Banker, Manager und die Mitglieder der Bundesregierung über Bord zu schmeißen wird wenig bringen, solange die Mehrheit der sonstigen Passagiere im kleineren Maßstab auch weiter das Falsche macht.
Ich habe jahrelang mit meinem Vater gestritten, weil für ihn Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze und für mich der Umweltschutz politisch wichtiger waren. Ich habe jahrelang versucht, meine besten Freunde entgegen ihrem Individualismus davon zu überzeugen, sich politisch zu engagieren. Ich arbeite weiter daran. Wenn die Mehrheit in die falsche Richtung paddelt, ist es der falsche Weg, die Schuld bei den Wenigen zu suchen, die dabei besonders große Ruder benutzen. Dieser Weg ist bloß attraktiv, weil man dann nicht mit seinen Eltern und seinen Freunden und Nachbarn streiten muss, wo es lang gehen soll.
Meine Eltern und ich sind jetzt jedenfalls schon mal der gemeinsamen Auffassung, dass es wesentlich mehr kollektives, öffentliches Eigentum und weniger Privateigentum geben sollte. Auf den Börsengang der Bahn sollten wir also tunlichst verzichten. Mit der Bahn kann man nämlich gegen die Entrichtung eines geringen Zinses trefflich zu Demonstrationen fahren und dabei über den Sinn von zinsbasierter Geldwirtschaft streiten.