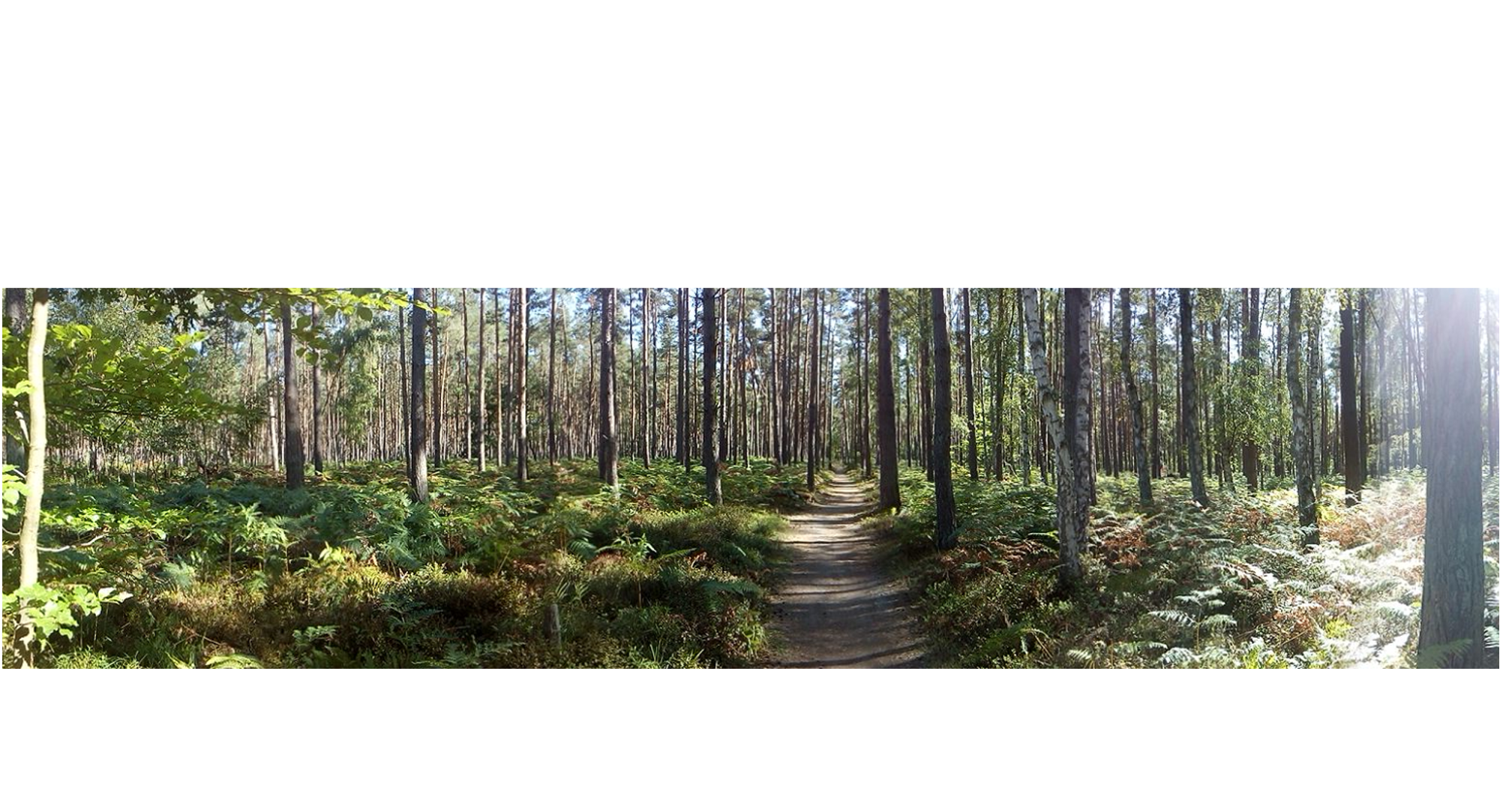Ein Kommentar zu Thomas Steinfelds Rezension des Buchs „Capital in the 21 Century“ von Thomas Piketty. („Der olle Marx“. In: Süddeutsche Zeitung Nr 92 vom 22.4.2014. S. 11.)
Die Leute streiten sich, welche Schlüsse die Politik aus der Finanzkrise ziehen soll. Man liest wieder Marx, denn der hat schließlich die Funktionsweise des Kapitalismus bereits vor 150 Jahren ziemlich minutiös analysiert. Dabei ist es nicht so schlimm, dass man Marx politische Forderungen nicht diskutiert, denn wer will heute schon noch die Diktatur des Proletariats? Es macht aber durchaus Sinn, Marx Analyse auf die Finanzkrise anzuwenden und daraus politische Schlussfolgerungen für eine Reform des Kapitalismus zu ziehen.
Pikotty schlägt solche Reformen vor, Steinfeld bezweifelt, dass sie möglich sind. In einem Punkt würde Steinfeld Pikotty zustimmen: Die extreme Ungleichverteilung von Gewinnen führt dazu, dass das Leistungsprinzip (wer viel leistet, verdient auch viel) zumindest für die Minderheit der Superreichen und die Mehrheit der Superarmen ausgehebelt ist, weil sich die Zugehörigkeit zu beiden Klassen einfach vererbt.
Pikettys Antwort auf die Ungleichverteilung von Reichtum ist sozialdemokratisch, sie lautet: Der Staat soll durch Abgaben und Steuern die Gewinne umverteilen und durch Regulation der Märkte die Krisen des Kapitalismus begrenzen. Im Prinzip ist das das alte fordistische Staatsmodell, das in den 70er Jahren unter dem Druck der Staatsschulden, die die USA für den Vietnamkrieg aufgenommen haben, und dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems stabiler Wechselkurse gescheitert ist. Seitdem haben wir einen relativ ungebremsten Siegeszug der „neoliberalen Konterrevolution“ (Hayek), die viele der Umverteilungs- und Regulationsmechanismen des keynesianischen Fordismus abgeschafft hat.
Steinfeld hat gar keine Antwort auf die Krise des Finanzkapitalismus außer einer ziemlich zynischen Schicksalsergebenheit: Er verweist einfach darauf, dass der Wettkampf der Nationen um das global sich bewegende Kapital alle Regulationsforderungen „illusorisch“ mache. Also kann man weiter FDP wählen und den Kapitalismus die nächste Krise produzieren lassen, und wenn es wieder eine durch Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln verursachte Hungerkrise ist. Danke für diese konstruktive Position.
Gleichzeitig ist Steinfeld aber Pikottys Analyse nicht tiefgehend genug, weil Marx und die klassischen Ökonomen wenigstens versucht hätten, eine Wirtschaftsform zu erklären, während Pikotty die Ungleichheit wie ein „utopischer Sozialist des 19. Jahrhunderts“ kritisiere. Der Begriff der Ungleichheit sei aber nicht „empirisch“, sondern eine „idealistische Setzung“.
Klingt schlau, ist aber vollkommener Schwachsinn. Die Tatsache, dass in Deutschland die reichsten 10% der Bevölkerung über 66,6% aller Vermögenswerte verfügen, während die ärmsten 50% der Bevölkerung davon gerade mal 1,4% besitzen, ist ein empirischer Fakt ohne jede „idealistische Setzung“.1 Wenn wir nicht mehr schreiben können, das 66,6% aller Vermögen nicht gleich 1,4% aller Vermögen sind, dann können wir gar keine statistische Aussage über die Wirklichkeit mehr machen.
Jetzt mache ich mal das, was Steinfeld irgendwann mal über Marx hat munkeln hören: Ich erkläre mal einige Aspekte der Finanzkrise des aktuellen Kapitalismus. Zum Beispiel die Funktion genau der oben empirisch festgestellten Ungleichverteilung von Vermögen. Die Funktionsweise ist eigentlich ziemlich banal, aber ausgesprochen wirkungsvoll: 50% der Menschen in Deutschland sind nämlich mangels Vermögen gezwungen, ihre Arbeitskraft an die reichen 10% zu verkaufen, um überhaupt leben zu können. Die reichen 10% besitzen die Produktionsmittel (zum Beispiel in Form von Geldkapital, oder von Aktien) und können dadurch den Mehrwert, den die 50% durch ihre Arbeit erzeugen, als Gewinn einstreichen. Der Staat hat dabei die Funktion, die Eigentumsordnung durch Gesetze, Polizei und Justiz zu schützen, so dass den reichsten 10% ihr Eigentum an Produktionsmitteln nicht verloren geht. Aber da war doch noch der Wohlfahrtsstaat mit Sozialhilfe und so. Na ja, das erklärt sich einfach: In der Phase der Systemkonfrontation mit dem Staatssozialismus des Ostblocks konnten die kapitalistischen Staaten von der organisierten Arbeiterschaft leichter gezwungen werden, die Mehrheit ihrer Bevölkerung auch an den Gewinnen zu beteiligen, die erwirtschaftet wurden, weil es eine Systemalternative gab. Daraus sind dann der New Deal von Roosevelt und die soziale Marktwirtschaft von Erhard und Schiller entstanden.
Dafür gabs aber noch einen weiteren Grund, und der war folgender: Der Kapitalismus hat permanent Krisen erzeugt, wie die Weltwirtschaftskrise ab 1929. Der Wohlfahrtsstaat hatte auch die Funktion, eine stabile Nachfrage zu erzeugen, die allzu harte Konjunkturdellen verhindern sollte.
Seit in den 1980er Jahren langsam sichtbar wurde, dass der Staatssozialismus schwächelt, konnten sich die Neoliberalen erst in England und den USA, dann in Deutschland und jetzt in Frankreich immer besser durchsetzen und haben die staatlichen Regulationen und Umverteilungen wieder zurückgebaut.
Dadurch sind jetzt aber neue Krisen entstanden, zum Beispiel die gegenwärtige Finanzkrise. Denn die Ungleichverteilung von Reichtum wurde durch die neoliberale Deregulierung so verstärkt, dass in USA die Mehrheit der Leute so wenig verdient hat, dass keine Nachfrage mehr da war: Die Leute hatten zum Beispiel kein Geld, Häuser zu kaufen. Auf der anderen Seite des Tisches hatten wenige Vermögende so viele Gewinne angehäuft, dass sie gar nicht mehr wussten, wie sie die anlegen sollten, um ihre 10-30% Rendite zu bekommen. Denn ohne genug Nachfrage nach Produkten gibt es auch keine Möglichkeit, den klassischen Weg der Geldvermehrung zu gehen: Geld in die Produktion zum Beispiel von Häusern zu stecken, die zu verkaufen und damit mehr Geld zu verdienen, als man in den Bau reingesteckt hat. Also haben die Vermögenden folgendes gemacht: Sie haben vermittelt über die Banken den geringverdienenden Lohnarbeitenden günstig Kredite gegeben, mit denen die dann zum Beispiel Häuser gekauft haben. Es entstand eine Blase, die Nachfrage nach Häusern wurde künstlich erhöht und die Häuser waren vollkommen überbewertet. Die Kredite, die diese Überbewertung erzeugt haben, waren aber teilweise das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt waren, weil die Leute so prekäre Jobs hatten, dass die Kredite massenweise nicht bezahlt werden konnten. Die Hypothekenblase platzte und die Finanzkrise brach los. Der Staat musste die pleite gegangenen Banken stützen. Nun zahlen die Steuerzahler der die Zeche.
Was die europäischen Regierungen jetzt machen, ist auch Umverteilung, bloß umgekehrt, nämlich von unten nach oben: Sie sichern mit Steuergeldern die Gewinne der Gläubiger, von Banken, Konzernen und Privatleuten. Die Lohnsteuer ist in Deutschland immer noch der größte Beitrag zu den Staatseinnahmen. Das damit eingenommene Geld steckt die Bundesregierung in Bankenrettungen, die bis zu 480 Milliarden Euro kosten könnten.
Daraus kann ich nur einen Schluss ziehen: Die Forderung nach Umverteilung ist nicht „illusorisch“, wie Steinfeld schreibt, sondern sie ist bereits Realität. Bloß eben in umgekehrter Richtung als Pikotty fordert.
Die große Frage, die ich mir nach all dem stelle, ist aber folgende: Wäre eine Umverteilung in sozialdemokratischer Manier, wie sie Pikotty fordert, eine vielversprechende Maßnahme gegen die Krisen, die der Kapitalismus dauernd erzeugt? Also können wir wirklich auf den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts mit Forderungen antworten, die im Prinzip auf einen Wohlfahrtsstaat hinauslaufen, der den Nationalstaaten der 1970er Jahre ähnelt?
Dafür spricht, dass man damit das Grundproblem lösen könnte, dass es zu einer extremen Anhäufung von Kapital kommt, ohne dass eine Nachfrage entstehen kann, die Marx klassischen Weg der Kapitalverwertung: Kapital (g) – Produktion – Verkauf – Kapital plus Profit (g‘) in Gang hält.
Dafür spricht auch, dass die Krise der Wohlfahrtsstaaten der 1970er Jahre vor allem eine Globalisierungskrise war, und eine weltweite Vermögenssteuer, wie sie Pikotty fordert, wäre eine internationale Antwort auf ein globales Problem und hätte schon deshalb nicht mehr dieselben Probleme wie der Keynesianismus der 1970er Jahre.
Dagegen spricht die Tatsache, dass es weltweit eine große Zahl von Staaten gibt, die eine solche Steuer nicht einführen würden, und in diese Staaten würde, insofern hat Steinfeld recht, viel Kapital auf der Suche nach mehr Rendite fließen. Deshalb ist die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer, wie sie attac fordert, eine unabdingbare flankierende Maßnahem zu einer Vermögenssteuer, weil man die Transaktion so besteuern kann, dass sobald einer der Handelspartner der Transaktion in einem europäischen Land oder den USA sitzt, die Steuer fällig wird. Da die wichtigsten Finanzplätze in der Welt immer noch New York und London sind, würden so die meisten Kapitalverschiebungen in ein vermögenssteuerfreies Land etwas kosten, ebenso wie der Rücktransfer in die Industrieländer. Und da der Großteil der realen Wertschöpfung nach wie vor in den Industrie- und Schwellenländern stattfindet, würde das Kapital auch nicht langfristig diese Länder vermeiden können. Außer natürlich im Falle von Nahrungsmittelspekulation, die mit der Not und dem Hunger in Entwicklungsländern Profit macht. Und wenn wir das nicht regulieren, da bin ich ganz idealistisch, dann bleibt der Kapitalismus einfach eine Wirtschaftsordnung, die die Menschenrechte mit Füßen tritt.
Für meine Begriffe sollte also als nächstes Folgendes passieren: Das TTIP der EU und der USA sollte tatsächlich abgeschlossen werden, allerdings nicht mit Deregulierungen, sondern mit Regulierungen für beide Seiten: Zum Beispiel sollte es eine auf beiden Seiten des Atlantiks erhobene Finanztransaktionssteuer auf alle Transaktionen enthalten, bei denen mindestens ein Handelspartner in den USA oder der EU sitzt. Außerdem sollte man sich auf eine gemeinsame, progressive Vermögenssteuer in beiden Wirtschaftszonen einigen.
Ich glaube nicht, dass das genügt, um zukünftige Krisen des Kapitalismus zu vermeiden. Aber vielleicht reicht es auch erst einmal, die demokratischen Staaten wieder handlungsfähiger zu machen und vielleicht nützt es einigen 100000 Familien in den USA und Europa, die dann nicht zwangsgeräumt werden. Das ist immerhin auch schon etwas.