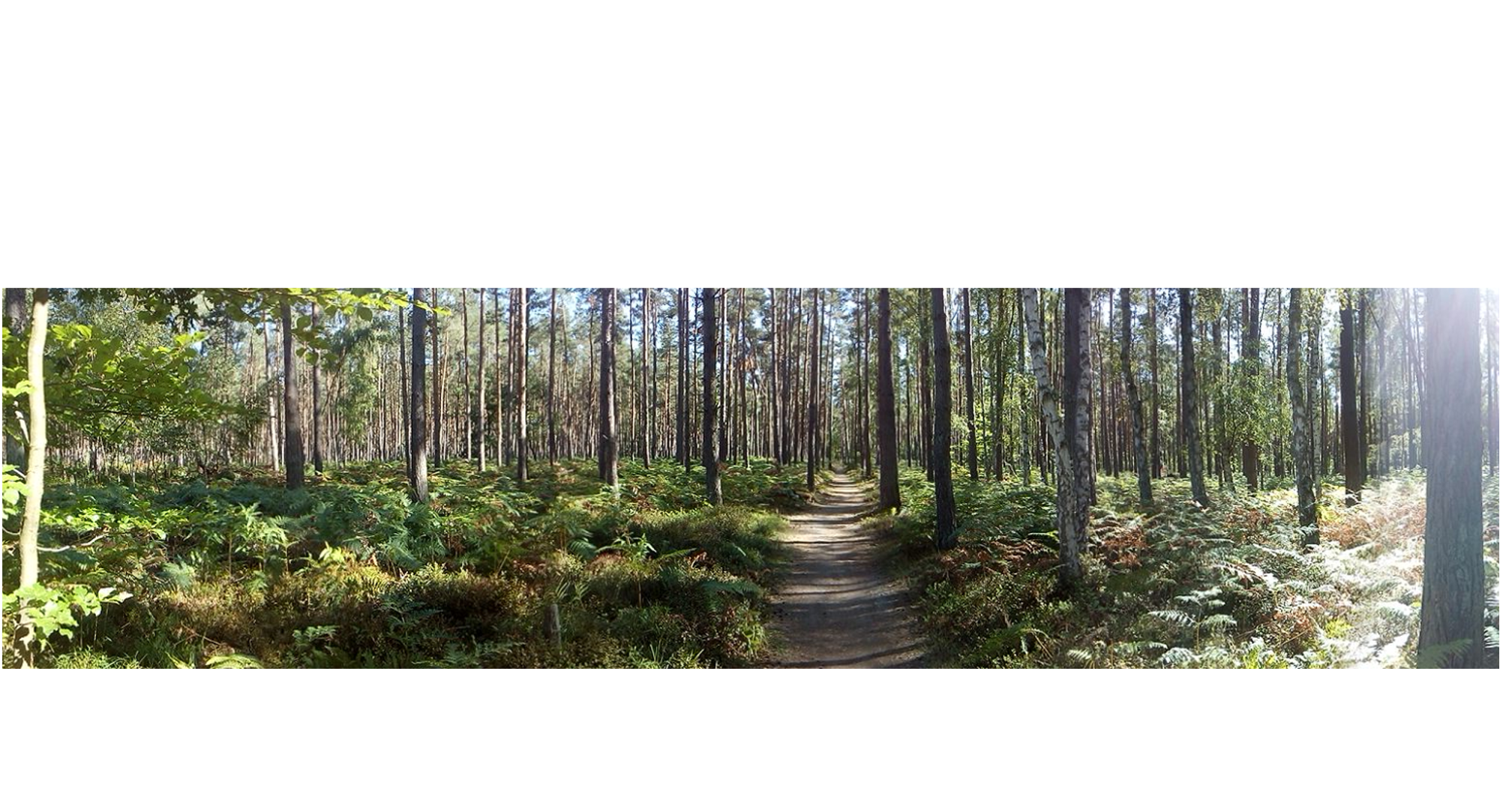Geld ist ein Mysterium – wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Das trifft nicht nur auf diejenigen unter uns zu, die schlecht wirtschaften können, so wie ich. Fragen wir Ökonomen, wie die Geldwirtschaft funktioniert, werden wir sehr viele verschiedene Antworten bekommen, die sich nicht zu einem Ganzen fügen: Die letzte Erklärung liegt im Dunkeln. Ich persönlich glaube, dass geldbasierte Wirtschaft in letzter Konsequenz so etwas wie eine magische Praxis ist, die auf dem Glauben der Teilnehmer daran beruht, dass die Praxis funktioniert und ihre Richtigkeit hat. Geldwirtschaft ist eine Wirtschaft, die nicht auf Wissen beruht, die Aufklärung ist hier gescheitert. Wenn ich in der Bäckerei an meiner Ecke einen alten Mann ein Geldstück über die Theke reichen sehe, das die junge Bäckerin lächelnd annimmt und ihm daraufhin eine Tüte Brötchen hinüberreicht, dann sehe ich eine magische Verwandlung mit zwei Seiten: Das Geld hat sich in die Brötchen verwandelt und umgekehrt. Das funktioniert genau so lange, wie beide Tauschpartner daran glauben, dass diese Verwandlung das Normalste auf der Welt ist, was sich daran zeigt, dass sie praktisch darin vertrauen, dass der jeweils andere die Regeln der magischen Praxis kennt und einhält.
Dass sich überhaupt Geld in Brötchen verwandeln muss, wird durch das Recht auf Privateigentum notwendig: Hätte der Bäcker kein Eigentumsrecht an seinen Brötchen, könnte jeder die Brötchen im Laden einfach mitnehmen und müsste kein magisches Kaufritual vollziehen. Mit dem Privateigentum kommt das Problem auf, wie alle an Sachen kommen, die andere produzieren, ohne dass alles total umständlich ist und ich morgens erstmal dem Sohn des Bäckers Rechtschreibung beibringen muss, um mir meine Brötchen verdienen zu können, dann mittags für die Telekom Flugblätter verteilen, um meine Telefonkosten zu begleichen und abends noch schnell bei der Näherin das Fenster reparieren muss, damit ich mir eine neue Hose verdiene. Stellt man sich vor, dass Millionen von Leuten täglich so Arbeit tauschen, merkt man schnell, dass das auf ein Chaos von kosmischen Ausmaßen hinausläuft.
Zauberhafterweise hat deshalb jemand das Geld erfunden: Es begrenzt das Chaospotential des Privateigentums, so dass wir im Alltag erstmal klarkommen und mit einem universellen Tauschmittel ganz unterschiedliche Werte tauschen können. Den Wert einer Arbeitsstunde eines Schreiners tauschen wir gegen den einer Arbeitsstunde einer Buchhalterin und den gegen den Wert eines Goldnuggets, den irgendein lucky bastard im Fluss gefunden hat, wofür er nur den ganzen Tag die Beine lang machen und sich dann kurz bücken musste.
Das Problem ist jetzt, dass die Praxis des Geldbenutzens einen Riesennachteil hat: Eigentlich dient ja Geld dafür, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dass wir alles selbst können und machen müssen: Ich muss also nicht Nähen können, um mir den Wunsch nach einer neuen Hose erfüllen zu können, es reicht, wenn ich Kindern Rechtschreibung beibringe und den Lohn dafür für die Hose ausgebe. Geld befriedigt aber illusionärerweise noch einen weiteren Wunsch: Den Wunsch, sich alle Wünsche erfüllen zu können, die jemals auftauchen werden. Ottfried Höffe hat den Wunsch nach Geld deshalb einen Wunsch zweiter Ordnung genannt: Wir wünschen uns, ein Mittel zu haben, mit dem wir alle Wünsche erfüllen können.1
Scheinbar bietet ein solches Mittel uns eine Menge Freiheit, weil es sozusagen unspezifisch genug ist, um damit viele verschiedene Wünsche erfüllen zu können.
Ulrike Ackermann lobt dann auch einen vom Kapitalismus ermöglichten „Eros der Freiheit“.3 Sie will die Freiheiten des kapitalistischen Wirtschaftssystems gegen den Zwang zu Gleichheit und staatlicher Verwaltung verteidigen. Das finde ich erstmal richtig. Aber was ist eigentlich Freiheit? Der Philosoph Harry G. Frankfurt hat folgendes Konzept von Willensfreiheit: Den Willen von Personen bezeichnet er als Wunsch zweiter Ordnung: Was wir wollen, sei davon abhängig, welche Wünsche wir uns wünschen. Wer sich nicht bestimmte Wünsche aussuchen und andere vernachlässigen kann, ist nach Frankfurt ein „Wanten“, jemand, der von seinen eigenen Wünschen durch die Gegend getrieben wird und sich nicht vernünftig überlegen kann, was er machen will. Im Volksmund bezeichnet man solches Verhalten dann auch als „willenlos“. Manche Männer im Vollrausch graben zum Beispiel unter Missachtung aller guten Sitten Frauen sehr platt an, weil der Alkohol ihre Fähigkeit, sich bestimmte Wünsche wünschen zu können und andere nicht handlungswirksam werden zu lassen, ausgeknipst hat.
Jetzt hat der Willensbegriff nach Frankfurt einen riesigen Haken: Personen haben nämlich nicht nur Wünsche, sondern auch Bedürfnisse, zumindest, wenn sie Menschen sind und keine Computer oder Vulkanier wie Dr. Spock. Und Bedürfnisse kann man sich jetzt wünschen oder nicht wünschen, die hat man einfach. Die katholische Kirche experimentiert zum Beispiel seit Jahrhunderten damit, das Bedürfnis ihrer Priester nach Sex mit Wünschen zweiter Ordnung auszuschalten, hat dazu ausgefeilte Techniken der spirituellen Belohnung und drakonische Strafen ausprobiert, und alles, was dabei herausgekommen ist, sind eine Menge unglücklicher Leute und missbrauchte Ministranten. Frankfurts Modell der Willensfreiheit funktioniert also nur für Wünsche, die wir auch zurückstellen können, nicht für Bedürfnisse.
Zu diesen Bedürfnissen gehört meines Erachtens alles für das Überleben der Spezies Mensch notwendige: Zum Beispiel Essen, Sex und Schutz vor Krankheit und einer feindlichen Natur. Das unterdrückerische, repressive am Kapitalismus ist jetzt, dass manche Leute mit ihren Eigentumsrechten die Bedürfnisse anderer Leute ausnutzen können, um ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Sie können nämlich Geld mit Eigentumsrechten verdienen, die ihnen die Kontrolle über die Bedürfnisbefriedigung anderer Menschen geben, zum Beispiel an Brötchen, oder Wasser, oder Häusern. Deshalb machen sie die Bedürfnisse anderer Menschen zu Instrumenten für ihre Wünsche. Deshalb sind Märkte, auf denen Verträge über solche Dinge abgeschlossen werden, nicht frei, denn einige Menschen instrumentalisieren andere, um ihre Wünsche zu erfüllen.2 Diese Möglichkeit zur Unterdrückung nutzen nicht nur Aktienmillionäre aus, sondern auch Lotte Schlichter von nebenan, die bei KiK eine Hose für 9,90 kauft, die von einer 14jährigen Näherin in Bangladesch zu einem Stundenlohn von 3 Cent genäht wurde.
Das uns Geld als etwas erscheint, was frei macht, hat meiner Meinung nach folgenden Grund: Im Kapitalismus wird für uns das Geld zum Modell für unsere Freiheit: „Wer den Zweck will, will auch das Mittel“, hat Kant geschrieben. Wir wollen frei sein, also überlegen wir, welches Mittel wir brauchen, um diesen Wunsch erfüllen zu können. Dabei drängt sich Geld auf: Denn Geld ist wie unser Wille eine Struktur zweiter Ordnung: Der Wille ist die Fähigkeit, Wünsche wünschen oder nicht wünschen zu können, und Geld ist ein Instrument, mit dem wir alle anderen Instrumente herstellen können.
Nehmen wir an, ich wünsche mir eine Hose. Deshalb kaufe ich mir die Arbeitskraft von Profi-Näherinnen mit meinem Geld. Damit mache ich sie zu einem Instrument für meine Wünsche, aber so lange die den Deal freiwillig eingehen, ist das erstmal keine Unterdrückung. Die Unterdrückung fängt da an, wo ich die Bedürfnisse anderer Leute ausnutze, um sie zu zwingen, für meine Wünsche die Instrumente zu sein. Das Problem an Frankfurts Freiheitsbegriff und dem des Kapitalismus ist jetzt meiner Meinung nach, dass beide systematisch verdecken, dass Leute auf breiter Front die Tatsache, dass wir alle Bedürfnisse haben, die wir uns nicht aussuchen können, ausnutzen, um andere Leute auszubeuten. Wenn wir jetzt noch ein psychologisches Modell menschlicher Bedürfnisse einbeziehen, das von Maslow entwickelt worden ist, können wir sehen, dass selbst unsere scheinbare Freiheit im Reich der Wünsche bloß eine Scheinfreiheit wird, wenn der Kapitalismus voll auf alle Lebensbereiche durchschlägt: Maslow zufolge bauen bei Menschen folgende Bedürfnisse pyramidenförmig aufeinander auf: 1. Physiologische Grundbedürfnisse (Essen, Sex), 2. Bedürfnis nach Schutz, 3. Bedürfnis nach Gemeinschaft, 4. Bedürfnis nach Anerkennung, 5. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Ich würde meine These von oben also insofern revidieren, als ich glaube, dass wir zwar, wie Frankfurt meint, wirklich teilweise frei zwischen Wünschen entscheiden können, aber dass wir das auf Ebene 1 und 2 von Maslows Bedürfnispyramide gar nicht, auf Ebene 3 vielleicht ein bisschen, auf Ebene 4 ein bisschen mehr und erst auf Ebene 5 dann ganz können. Da aber die unteren Ebenen Voraussetzung für Ebene 5 sind, wird unsere Freiheit als Person in einer Gesellschaft, die Bedürfnisse nutzt, um Profit zu generieren, immer wieder zunichte gemacht. Wenn mir zum 20. Mal die Selbstverwirklichung zusammenkracht, weil die Gesellschaft mein Bedürfnis nach Anerkennung nutzt, um mich zu Lohnarbeit zu zwingen, dann gebe ich vielleicht diese 5. Ebene irgendwann ganz auf. Und genau das passiert im Kapitalismus flächendeckend mit unserer Freiheit. Deshalb ist er ein unvernünftiges System, das nur funktioniert, solange wir alle glauben, mehr Geld bedeute mehr Freiheit. Die geldvermittelte Freiheit des Kapitalismus ist aber, weil sie die Bedürfnisse von Menschen zu deren Unterdrückung benutzt, ziemlich unerotisch. Echte Freiheit ist, da würde ich Ackermann zustimmen, tatsächlich erotisch. Aber echte Freiheit gibts nur dort, wo der Kapitalismus nicht herrscht.
1Ottfried Höffe: Lebenskunst und Moral. C.H. Beck.
2Vgl. Wolfgang Fritz Haug: Kritik der Warenästhetik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
3Vgl. Ulrike Ackermann: Eros der Freiheit. C.H. Beck 2008.